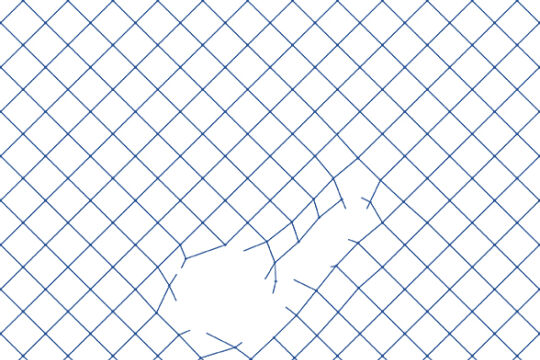Der Weg zum Sozialamt ist oft der letzte Versuch, Hilfe zu bekommen - zu groß ist die Scham, die eigene prekäre Situation öffentlich bekannt zu geben. 90 bis 95 Prozent der anspruchsberechtigen Personen nehmen die bedarfsorientierte Mindestsicherung laut Martin Schenk von der Armutskonferenz erst dann an, wenn sie schon alles andere versucht haben: wenn die möglichen Hilfsressourcen der Familie ausgereizt sind und auch die letzten verbliebenen Freunde nicht mehr helfen können. "Entgegen dem öffentlichen Vorurteil ist es eben nicht so, dass alle gleich zum Amt marschieren und sich ihr Geld abholen", weiß Schenk. "Nur etwa die Hälfte der Leute, die Mindestsicherung in Anspruch nehmen könnten, tun das auch." Hat man sich als Betroffener dazu durchgerungen, stößt man laut Armutskonferenz in einigen Bundesländern auf das nächste Hindernis: Statt einer zweckdienlichen Untersuchung der Situation des Antragstellers würden immer mehr Menschen darauf verwiesen, zuerst ihre Eltern oder volljährigen Kinder auf Unterhalt zu klagen.
Abschreckende Wirkung
Aus Angst, innerfamiliäre Konflikte auszulösen, bringen viele Bedürftige deshalb keinen Antrag ein. Die Wurzel dieser Praxis liegt im sogenannten Angehörigen-Regress: Bevor die bedarfsorientierte Mindestsicherung im Jahr 2011 bundesweit eingeführt wurde, galt für Verwandte von Sozialhilfebeziehern eine Ersatzpflicht für bezogene Leistungen. Eltern, Großeltern oder volljährige Kinder mussten unter bestimmten Voraussetzungen empfangene staatliche Hilfeleistungen für einen Angehörigen zurückerstatten. "Dieser Regress hat dazu geführt, dass viele Armutsbetroffene, die Hilfe gebraucht hätten, nicht auf das Sozialamt gegangen sind, um sich Unterstützung zu holen. Sie hatten Angst, dass jemand in der Familie oder sie selbst alles einmal zurückzahlen müssen", erklärt Schenk. Dass diese Form der Sozialhilfe nicht wirklich hilfreich ist, findet auch Norman Wagner, Sozialrechtsexperte der Arbeiterkammer Wien: "Den Leuten wird es dadurch zusätzlich erschwert, aus der Armut herauszukommen."
Den Angehörigen-Regress gibt es in dieser Form heute zwar nur noch in Kärnten, durch die neue Praxis gewisser Sozialämter, Antragstellende auf Unterhaltsklagen zu verweisen, werden Hilfesuchende aber -wie schon vorher beim Regress - abgeschreckt und letztendlich ihrem eigenen Schicksal oder den Geldbörsen der Angehörigen überlassen. Konkret ortet die Armutskonferenz vier Bundesländer, in denen diese Vorgehensweise gemeldet wurde: Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und das Burgenland. Wobei diese Praxis nicht notwendigerweise im gesamten Bundesland angewandt wird, schränkt man ein.
Der Verweis auf eine Unterhaltsklage sei jedenfalls nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich fragwürdig. "Eine Unterhaltspflicht zwischen den volljährigen Kindern und ihren Eltern besteht nur dann, wenn jemand nicht selbsterhaltungsfähig ist, also wenn etwa eine Behinderung vorliegt", so Schenk. Dies würde in Oberösterreich sehr wohl berücksichtigt, heißt es aus dem Büro von Soziallandesrätin Gertraud Jahn (SPÖ). Forderungen, dass vor einem Antrag auf Mindestsicherung die Familie belangt werden müsse, würde man in den Sozialämtern nicht stellen. Das würde auch die steigende Anzahl an Mindestsicherungsbezieher zeigen. Auch in Niederösterreich würde man nur gemäß der gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen anstelle eines Antrages auf Mindestsicherung Unterhaltsansprüche an die Familien stellen, heißt es. Dass es trotzdem immer wieder Meldungen über falsche Auskünfte in Sachen Mindestsicherung gibt, erklärt sich Sozialrechtsexperte Wagner mit dem finanziellen Druck, der in den Ländern vor allem im Sozialbereich herrsche. Dieses Argument hält auch Wirtschaftsforscher Thomas Url vom WI-FO für plausibel: "Entweder handelt es sich um Unwissenheit, und es wurde auf Verwaltungsebene einfach nicht genügend informiert , oder aber es handelt sich um Willkür einiger Personen, die denken, sie müssten die öffentlichen Haushalte auf eigene Faust schonen."
Besonders Kärnten steht im Zentrum der Kritik der Armutskonferenz. Dort hielt man sich -wie auch in der Steiermark -nach der Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung nicht an diesen Bund-Länder-Vertrag und führte erneut den Angehörigen-Regress ein. In der Steiermark wurde dieser Regress Anfang Juli diesen Jahres wieder aufgehoben, in Kärnten ist die Ersatzpflicht nach wie vor in Kraft. "Seit einem Jahr heißt es, dass der Regress nun abgeschafft werde", kritisiert Schenk, passiert sei das nach wie vor nicht. Bereits im Februar hatte die zuständige Soziallandesrätin Beate Prettner (SPÖ) eine umfassende Neuerung der Mindestsicherung angekündigt. Als mögliches Motiv für die Beibehaltung könnten zwei positive Effekte des Regresses in Frage kommen: Einerseits würden laut Wirtschaftsforscher Thomas Url die öffentlichen Kassen durch die Regresszahlungen der Verwandten enorm entlastet. Dasselbe Resultat ergäbe sich indirekt aus einer zurückhaltenden Inanspruchnahme, die durch die abschreckende Wirkung des Regresses zustande käme. Andererseits wirkt sich die Ersatzleistung auch auf den Arbeitsmarkt aus: "Mit ihm hat man mehr Anreize, keine Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, sondern eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Immer wenn solche Leistungen angeboten werden, besteht ein gewisses Risiko, dass sich Personen aus dem Arbeitsleben zurückziehen", so Url.
Vorarlberg, Wien und Salzburg als Vorbilder
Ob Angehörigen-Regress oder fragwürdige Verweise auf Unterhaltsklagen: Für Martin Schenk von der Armutskonferenz liegt der Weg zur Besserung der Situation von armutsgefährdeten Österreichern vor allem in der Vorbildwirkung bestimmter Länder: "Man sollte sich einfach die Regelungen in Vorarlberg, Wien und der Stadt Salzburg ansehen", fordert er. Die gesetzlichen Regelungen wären -bis auf Kärnten - überall stimmig, im Vollzug brauche es aber vor allem auf Bezirksebene wachsame Augen. Zudem wünscht sich Schenk stärkere Kontrollen im Sozialbereich: "Eine Aufforderung zur Unterhaltsklage wäre beispielsweise im Gesundheitsbereich nicht denkbar. Man würde sofort mit Klagen und öffentlichen Kontrollen eingedeckt."
Eine Lösung zu finden, die sowohl für die Staatskassen als auch für hilfesuchende Bürger zufriedenstellend ist, sei schwierig, meint Sozialrechtsexperte Wagner. Ökonomisch und moralisch hält er es jedenfalls für zweckmäßig, wenn man Antragstellende unterstützt, ohne auf die Familie zurückzugreifen: "Das sind Leute, die kein Geld haben - also müssen sie das Erhaltene wieder ausgeben, und das wäre im Sinn einer Konjunkturbewegung sinnvoll", meint er. "Außerdem ist es für die Gesellschaft und für den sozialen Frieden auf jeden Fall förderlicher, wenn man Hilfebedürftige unterstützt."