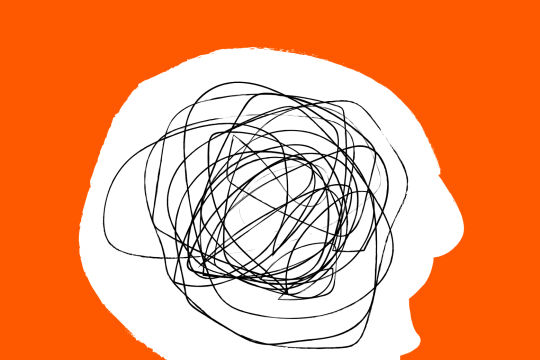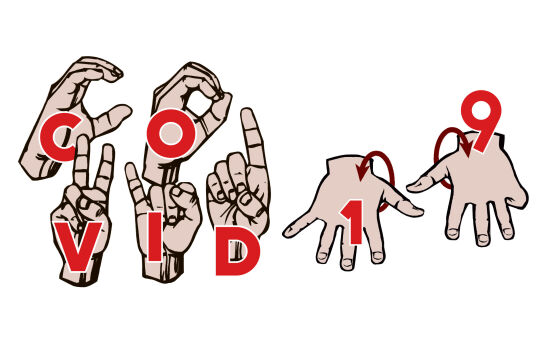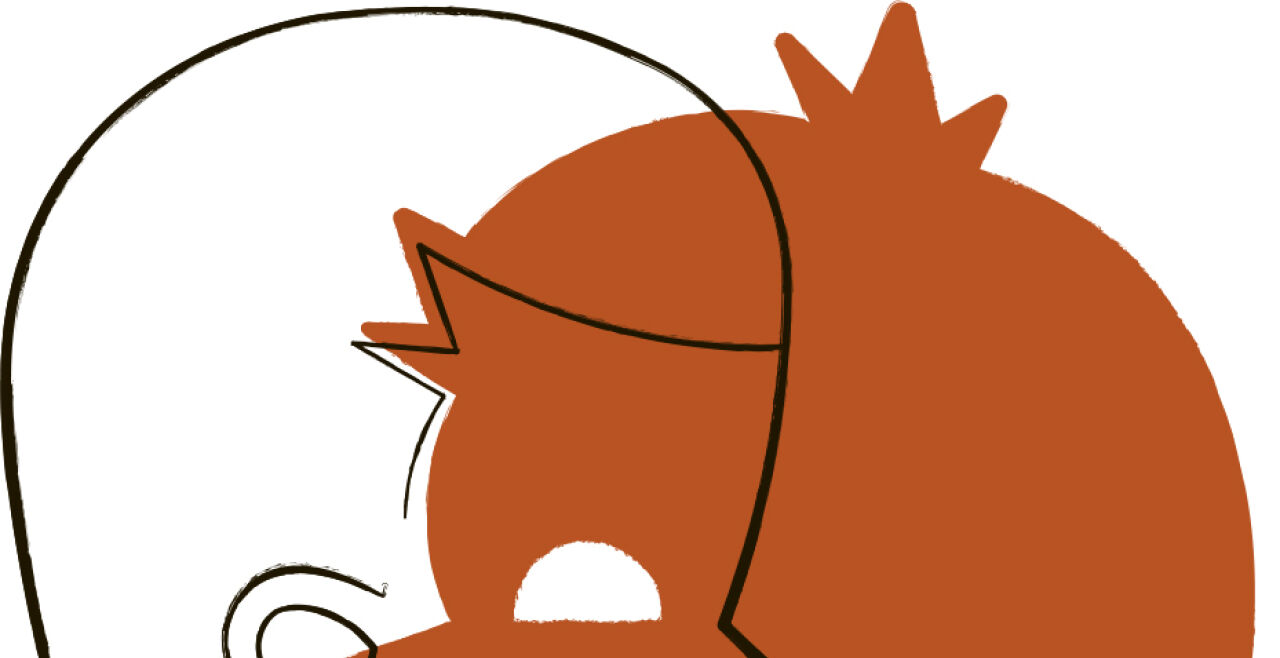
Bewältigung psychosozialer Krisen und Suizidgefährdung
Manchmal erscheinen schwierige Situationen ausweglos. In der Pandemie nehmen diese zu. Worauf es bei der Bewältigung von psychosozialen Krisen und bei der Suizidprävention ankommt.
Manchmal erscheinen schwierige Situationen ausweglos. In der Pandemie nehmen diese zu. Worauf es bei der Bewältigung von psychosozialen Krisen und bei der Suizidprävention ankommt.
Im Jahr 2018 starben in Österreich 1209 Personen durch Suizid. Anlässlich des Welttags der Suizidprävention am 10. September spricht Claudius Stein, ehemaliger Leiter des Kriseninterventionszentrums, mit der FURCHE über psychosoziale Krisen und Suizidgefährdung – und darüber, welche Risiken die Coronakrise birgt.
DIE FURCHE: Wie kommt es zu psychosozialen Krisen oder sogar Suizidgefährdung?
Claudius Stein: Wenn jemand von einem Schicksalsschlag betroffen ist, zum Beispiel eine wichtige Person durch einen Todesfall oder eine Trennung verloren hat, die Diagnose einer schwerwiegenden Krankheit erhalten hat oder der Arbeitsplatz bedroht ist, sollte man nachfragen, wie es der Person in dieser Situation geht. Zu einer Krise kommt es, wenn Menschen mit derartigen Ereignissen überfordert sind und für sich keine Lösungsmöglichkeiten mehr sehen.
DIE FURCHE: Auf welche Warnsignale sollte man als Angehöriger achten, um eine solche Krise zu erkennen?
Stein: Die Symptome können vielfältig sein, etwa depressive Verstimmungen, Angstzustände, psychosomatische Beschwerden oder Schlafstörungen. Viele Menschen erleben eine Fülle von Emotionen, die oft widersprüchlich sind und sie überfordern. Manche ziehen sich zurück und reden nicht mehr über ihre Probleme. Andere können nicht mehr kontrollieren, was sie tun. Wenn sich die Situation dann so zuspitzt, dass jemand gar nicht mehr weiterweiß, können auch Suizidgedanken auftreten. Ein wichtiges Warnsignal ist auch, wenn die Werte, die bisher im Leben wichtig waren, plötzlich nicht mehr zählen. Die meisten Betroffenen äußern ihre Suizidgedanken auch in der einen oder anderen Form. Manche sogar sehr direkt. Wichtig ist, solche Äußerungen unbedingt ernst zu nehmen und nach Möglichkeit das Gespräch zu suchen.
Die psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie wurden vernachlässigt. Jetzt wäre der Zeitpunkt, dies zu evaluieren und entsprechend zu reagieren.
DIE FURCHE: Suizid wird oft als Entlastung gesehen, wenn Betroffene feststellen, dass sie so nicht weiterleben können. Wie kann man diesen Druck von Gefährdeten nehmen?
Stein: Es kommt natürlich auf die Situation an. Das Wichtigste ist, jemanden zu finden, mit dem man reden kann. Das können Angehörige oder Freunde und Freundinnen sein. Aber wenn die Not sehr groß ist, ist es sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu suchen. Entscheidend ist, dass Betroffene ihre Gedanken und Gefühle offen aussprechen können und dabei ernst genommen und nicht verurteilt werden. Es soll ein vertrauensvolles Gesprächsklima entstehen, dann ergeben sich oft schon andere und neue Perspektiven.
Man kann fragen: Welche Problemlösungsstrategien und Ressourcen stehen normalerweise zur Verfügung, um mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen, und warum können diese aktuell nicht genutzt werden? Wie bewertet man das, was einem wiederfahren ist? Wichtig ist das richtige Einordnen der Situation. Oft fehlt den Menschen auch die Information, wo sie konkrete Hilfestellung bekommen können, etwa bei Arbeitslosigkeit oder bei finanziellen Problemen.
DIE FURCHE: Stichwort Arbeitslosigkeit – welche besonderen Herausforderungen birgt die Coronakrise, angesichts erhöhter Arbeitslosigkeit, verstärkter Isolation und der getroffenen Maßnahmen?
Stein: Zuerst ist es wichtig, nicht zu pauschalisieren. Nicht alle Menschen sind in gleicher Weise von der Pandemie betroffen. Ich würde sagen, es gibt vier sehr belastete Personengruppen, aus denen viele Menschen psychosoziale Unterstützung benötigen:
- Erstens jene Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankt sind. Natürlich ist hier primär das medizinische System gefordert, es ist jedoch wichtig, auch die psychosozialen Folgen zu beachten. Einerseits, weil schwere Krankheiten ohnehin sehr belastend sind, andererseits wegen der besonderen Umstände in der Pandemie. Auch Angehörige benötigen oft Unterstützung. Die zusätzliche Isolation durch die Kontakteinschränkungen ist für den Kranken wie auch seine Angehörigen hoch belastend. Natürlich braucht es auch ein Unterstützungsangebot für jene, die in der Pandemie nahestehende Menschen verloren haben.
- Zweitens brauchen jene Menschen Unterstützung, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die wirtschaftlich in Not geraten sind oder das vielleicht vorher schon waren und deren Situation sich jetzt noch zugespitzt hat.
- Drittens Familien mit kleinen Kindern, die in mehrfacher Hinsicht in einer sehr schwierigen Situation waren und noch sind. Besonders Frauen sind belastet, und Gewaltschutzorganisationen stellen leider auch einen Anstieg innerfamiliärer Gewalt fest.
- Viertens sind psychisch kranke Menschen eine sehr verletzbare Gruppe. Es gab und gibt Menschen, die sich aufgrund ihrer Ängste immer noch isolieren und einsam zu Hause sitzen. Wir haben in der Zeit der Kontaktbeschränkungen viele Gespräche über Telefon oder Video geführt, und das wird auch weiterhin angeboten. Denn jede Form von Kontakt ist in einer derartigen Ausnahmesituation wichtig und besser als gar kein Angebot.
DIE FURCHE: Das Suizidrisiko ist bei älteren Menschen deutlich höher als im Durchschnitt. Auch in der Coronakrise gelten sie als Risikogruppe. Welche Gefahren einer psychosozialen Krise stecken hier dahinter – denkt man etwa an Ausgangsbeschränkungen und Besuchsverbote in Pflegeheimen? Und wie kann man ältere Menschen davor bewahren?
Stein: Ohne die im Frühjahr getroffenen Maßnahmen infrage zu stellen, muss man jetzt Überlegungen anstellen, wie Beziehungen und Kontakte auch unter solch außergewöhnlichen Umständen gepflegt werden können. Gerade ältere Menschen sind gefährdet, den Lebensmut zu verlieren. Da stellen sich Fragen wie: „Werde ich überhaupt noch gebraucht? Gibt es Interesse an mir und dem, was ich kann und weiß?“ Diese Dinge geben dem Leben Sinn. Viele ältere Menschen haben ein sehr positives Umfeld, die Mehrheit findet im Alter noch neue positive Lebensmöglichkeiten für sich. Aber gerade jenen, für die das schon vor der Pandemie schwierig war, sollte unsere verstärkte Aufmerksamkeit gelten. Da braucht es auch nachgehende Unterstützung, da viele nicht von sich aus Hilfe suchen.

Claudius Stein
Claudius Stein ist Arzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapeut und war lange Zeit ärztlicher Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien.
Claudius Stein ist Arzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapeut und war lange Zeit ärztlicher Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien.
DIE FURCHE: Sie waren jahrelang Leiter des Kriseninterventionszentrums – was hat sich in dieser Zeit getan?
Stein: Grundsätzlich ist das Angebot an psychosozialer Unterstützung deutlich größer und besser geworden. Es ist einfacher geworden, sich Hilfe zu holen, und auch das Thema Suizidalität ist nicht mehr so tabuisiert. Es gibt mittlerweileeine österreichweite Kooperation von in der Suizidprävention tätigen Personen (SUPRA – Suizidprävention Austria, Anm. d. Red.), die einige wichtige suizidpräventive Projekte für spezielle Zielgruppen umsetzen, wie zum Beispiel ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Familienväter in Krisen oder Hinterbliebene nach dem Suizid nahestehender Personen. Wir haben ein Schulungskonzept fürsogenannte Gatekeeper – also Personen, die mit Suizidgefährdeten zu tun haben – entwickelt und bieten österreichweit Schulungen an. Insgesamt bin ich nicht unzufrieden – wiewohl noch viel zu tun ist.
DIE FURCHE: Und zwar?
Stein: Zum Beispiel der Ausbau psychosozialer Versorgung im ländlichen Bereich. Es braucht eine Verankerung von Krisenintervention in jedem Bundesland, auch mehr kassenfinanzierte Psychotherapie und die Versorgung mit Fachärzten im ländlichen Raum. Ich würde mir eine gesetzliche Verankerung der Finanzierung von Krisenintervention und Suizidprävention wünschen. Die psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie wurden in der akuten Phase vernachlässigt, was in gewisser Weise auch nachvollziehbar ist, weil es eben andere Prioritäten gab. Aber jetzt wäre der Zeitpunkt, dies zu evaluieren und entsprechend zu reagieren – auch inHinblick darauf, was zu tun ist, sollte sich die Pandemiesituation womöglich wieder zuspitzen.
Hilfe im Krisenfall
- Österreichische Telefonseelsorge: 0–24 Uhr, kostenlos unter 142
- Kriseninterventionszentrum: www.kriseninterventionszentrum.at
Der Papageno-Effekt
Wie soll über suizidale Erfahrungen berichtet werden? Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien veranstaltet ein Symposium zur Art und Anmut von Suizid-Berichterstattung. Im Idealfall kann diese präventive Wirkung haben: den „Papageno-Effekt“.
Der Papageno-Effekt
14. Oktober, 17–20 Uhr
Presseclub Concordia, 1010 Wien
und online unter: papageno.vsum.at




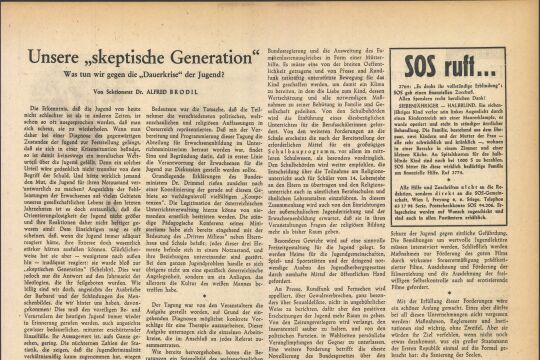









































.jpg)