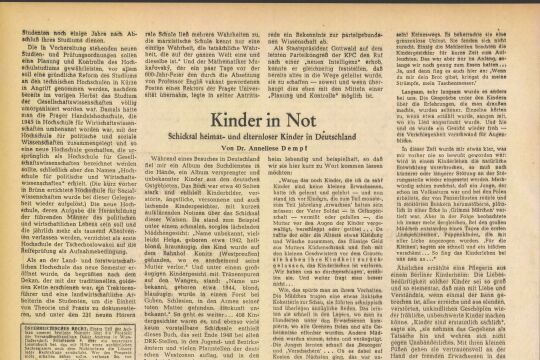75 Jahre DIE FURCHE
DISKURS
Identität: Ein Versteckspiel
Identität ist nur ein Wort, das klingt. Für unsere Autorin, die in den 1990er Jahren mit ihrer Familie vor dem Jugoslawien-Krieg geflüchtet ist, wurde das Wort zu einem Spiel.
Identität ist nur ein Wort, das klingt. Für unsere Autorin, die in den 1990er Jahren mit ihrer Familie vor dem Jugoslawien-Krieg geflüchtet ist, wurde das Wort zu einem Spiel.
Als meine Mutter mit meiner Schwester und mir 1992 in den Bus stieg, dachte sie nicht an Flucht oder Vertreibung oder gar Krieg. Sie dachte an den Geburtstag unserer Großmutter. Kurz bevor wir uns auf den Weg von einer kleinen Stadt im ehemaligen Jugoslawien nach Kärnten zu unserem Gastarbeiter-Onkel machten, hatte Mutter für das Fest eingekauft. Oblaten, Kraut, ein Huhn, Eier, Zucker, Bier und Wein. Der Plan war, dass wir für kurze Zeit wegfahren, wie auf Urlaub, und pünktlich zu Großmutters Geburtstag wiederkommen. Nur kurz, nur zur Sicherheit. Mutter verließ ihre Wohnung, der Kühlschrank blieb voll. Dass sie diese Wohnung nie wieder betreten würde, daran dachte Mutter nicht.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Ich war vier Jahre alt, als wir Jugoslawien verlassen haben. Ich habe keine Erinnerungen an den Tag. Dennoch wurde meine Identität von dem Moment an zu einem Spiel, einem Versteckspiel. Und dieses dauert – anders als der Krieg – bis heute an. Als Kind lernte ich, bloß nicht aufzufallen. Vielen jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund geht es ähnlich. Ich beherrschte das Schauspiel, und ich kann es auch heute jederzeit abrufen. Ich mime jenen Aspekt meiner Identität, der gerade gut ankommt. Ich bin viele, ich kann viele. Ich wollte niemandem Unannehmlichkeiten bereiten, bloß nie stören.
Ist doch nur ein Name, oder?
Als ich vor zwölf Jahren anfing, als Journalistin zu arbeiten, hatten die Redaktionen häufig Probleme mit dem Háček, dem Häkchen über dem „c“. Manche Redaktionssysteme hatten dieses Sonderzeichen einfach nicht. Und so strich ich den Háček prompt aus meinem Familiennamen. Ist doch nur ein Name, oder? Nicht auffallen wurde zu meinem Sport, meiner Disziplin. In meinen ersten Kindheitserinnerungen nannten mich Kinder aus der Volksschulklasse „Jugo“. „Ein Jugo. Was soll das sein?“, fragte ich mich. Ich solle zurückgehen, wo ich herkomme, sagten sie. Ich war sieben Jahre alt, ich wusste damals nicht, was Jugoslawien war und wo das sein soll.
Meine Eltern sprachen zu Hause nicht über den Krieg. Zumindest nicht mit mir. An dieses „Zurück“ also hatte ich keine Erinnerungen, dazu kein Wissen. Kärnten war mein Zuhause. Und ehe es mir bewusst war, hatte ich mich wohl „integriert“, da es für mich keinen anderen Ort gab, den ich je gesehen oder erlebt hätte. Später begriff ich: Es ist nicht das Land, in dem man geboren wurde, das einen prägt. Es ist das Land, in dem man lebt, sozialisiert wird und Erinnerungen teilt. Für viele Menschen sind diese beiden Länder dieselben. Das war der einzige Unterschied zwischen mir und meinen Klassenkameraden. Wenn wir nach Kriegsende in den Sommerferien nach Bosnien fuhren, um unsere Verwandten zu besuchen, fühlte ich mich unwohl. Bei jedem Grenzübertritt hatte ich ein mulmiges Gefühl. Auch hier entdecke ich Ähnlichkeiten mit anderen Menschen, die gleiche Erfahrungen teilen. Dieses Gefühl wurde meine vertraute Konstante, in verschiedenen Situationen.
Gegen Ende meiner Schulzeit etwa rückte Jörg Haider zum Taferl-Verschieben aus. Zwei Schulkolleginnen von mir schwänzten an diesem 8. Februar 2006 die Schule, um ihm zuzusehen und ihn anzufeuern. Haider griff selbst zur Schaufel und trug die zweisprachige Bleiburg/Pliberk-Ortstafel ein paar Meter weit, um sie wieder eingraben zu lassen. Hatte das was mit uns zu tun?
Noch vor Haiders tragischem Tod verließ ich Kärnten und zog nach Wien. Studienkollegen und -kolleginnen fragten, wo ich herkomme. Der Balkan war plötzlich en vogue. Wir feierten die Nächte durch, im Ost Klub, zur Musik von Balkan-Brass-Bands. Meine Kollegen wollten mit mir nach Kroatien, Bosnien und Serbien fahren, eine Tour machen. Oftmals spielte ich die lustige Balkanerin, weil es von mir erwartet wurde. Ich war gut darin, herauszufinden, welches Bild sich andere von mir machten, und dieses zu bedienen. Ich glaube, so geht es vielen Menschen, egal ob sie Migrationserfahrung haben oder nicht. Alle möchten dazugehören, alle möchten Anerkennung. Es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, das uns alle eint. Aber an einem Ort, war ich von all dem befreit.
Manuela Tomic im FURCHE Podcast
Ich liebte das Lesen, verbrachte Stunden in der Stadtbücherei. Es war der einzige Ort, an dem ich nicht dazugehören musste. An dem es nur Bücher und mich gab. Schon als Kind merkte ich meine Liebe zur deutschen Sprache. Mit der Integrationsdebatte hatte ich aber immer meine Probleme. Vielleicht, weil es mich nie betraf. Doch als ich langsam begann, die Schriftsteller Ivo Andrić, Bora Ćosić, oder etwa Miljenko Jergović, zu lesen, überkam es mich. Ich hatte die deutschen Ausgaben gekauft und versuchte, den Kanon meiner Muttersprache auf Deutsch nachzuholen. Eines fiel mir beim Lesen sofort auf: Die Perspektive des Kindes stand im Vordergrund. Es ist die Naivität, mit der häufig Brutales erzählt werden kann. Vielleicht brauchen Schriftsteller dieses Vehikel, da es sonst zu schmerzhaft wäre. Auch ich spiele, wenn es ernst wird, häufig die Rolle des Kindes.
Vom Reparieren der Klaviere
Ćosić erzählt in seinem Roman „Wie unsere Klaviere repariert wurden“ in dem gleichnamigen Kapitel von den Reihen der Klavierstimmer, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gelichtet hatten. Meist waren es Juden oder andere „gefährdete Nationen“, die dem Beruf nachgegangen waren. Er erzählt also, wie sich ein Tscheche nach dem Krieg auf den Weg machte, um die unbrauchbaren, alten, kaputten Klaviere zu reparieren. „Die Klaviere gesundeten langsam in unserer großen Stadt, die Straßen, Parks, die feierlichen Plätze und besonders die Ruinen mit der ausgezeichneten Anordnung ihrer verstümmelten Mauern hallten wider ...“, schreibt Ćosić.
Die jugoslawische Literatur auf Deutsch zu lesen war meine eigene Art, Klaviere zu reparieren. Die Worte erklingen, und nationale Grenzen werden unbrauchbar. Die Worte erklingen – auch „Identität“ ist nur ein Wort, das klingt. Es ist ein intimes Gefühl, über das sich bei anderen nur schwer urteilen lässt. Meine Identität bleibt ein Spiel. Sie ist beweglich. Ich finde sie in der Literatur und manchmal auch in Mutters vollem Kühlschrank, in den Speisen meiner Kindheit: Pita, Oblaten und dem Geruch von Šljivovica zu Großmutters Geburtstagsfeier, die nie stattgefunden hat. Doch vielleicht schreibe ich nur, was von mir erwartet wird – einfach, um nicht aufzufallen.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!