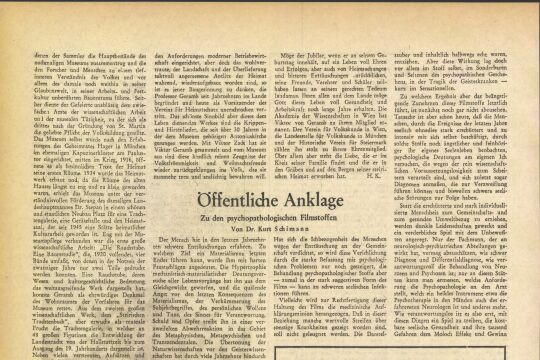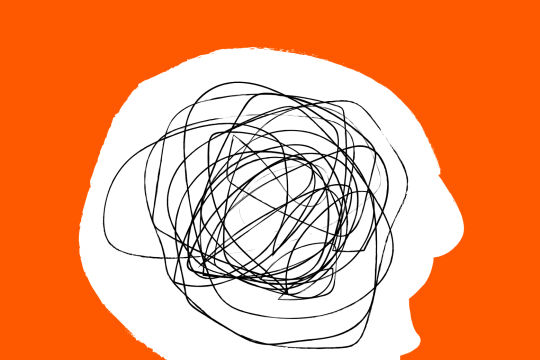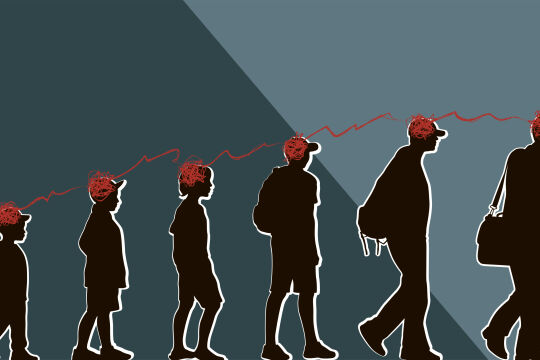Seit Wochen liefern die Medien intensive Bilder von Terror, Krieg, Gewalt und Tod. Manche Kinder verkraften diese Konfrontation mit der grausamen Realität nicht unbeschadet.
Für den 12-jährigen Andreas hat sich die Welt seit dem 11. September verändert. Wochenlang schon wirkt er depressiv, ständig will er über die Geschehnisse reden. Terror, Krieg, Tod, das sind seine Themen. Die Mutter, selbst überängstlich, hält ihn von Kriegsbildern fern, versucht ständig, ihn zu trösten und abzulenken. Nur keine Bilder und keine Berichte vom Afghanistankrieg! Neuerdings lässt sie den Buben von einem Akupunkteur behandeln ...
Ein drastischer Einzelfall? Wenn man den ersten öffentlichen Reaktionen nach den dramatischen Ereignissen in den USA glaubt, keinesfalls. Es habe "nur noch Kinder gegeben, die wie hypnotisiert waren, nur stockend erzählten und ihre Gefühle kaum in Worte fassen konnten" klagte eine TV-Moderatorin im Schock über die Ereignisse. Und wenn es stimmte, was zahlreiche Kinderexperten in den Medien verbreiteten, dann war die Welt der Kinder völlig aus den Angeln gehoben. "Die Terrorattacken stellen das mentale Weltbild der Jugendlichen in Frage", meinte der bekannte Jugendpsychologe Allan Guggenbühl in der Neuen Zürcher Zeitung. Niemand werde sich in Zukunft mehr sicher fühlen, prophezeite der Trauma-Spezialist Leslie Carrick-Smith von der Britischen Gesellschaft für Psychologie. Und Thomas Pollak, der Vorsitzende des renommierten Psychoanalytischen Instituts in Frankfurt war sich sicher, die TV-Bilder hätten eine traumatisierende Wirkung auf alle Menschen.
Abseits der ersten medialen Übererregung lässt sich nunmehr mit zeitlicher Distanz gelassener über die Folgewirkungen der schrecklichen Ereignisse resümieren. Was hat sich in den Seelen und Köpfen unserer Kinder seit dem abscheulichen Terroranschlag tatsächlich abgespielt? Haben sie die Bilder des Terroranschlages, der Katastrophengefahr, Milzbrand-Alarm, Bomben und Krieg in Afghanistan einfach weggesteckt oder haben sie - wie vielfach behauptet - tatsächlich Traumata mit Langzeitfolgen erlitten? Und: Welcher Art waren die an ihr Innerstes gerichteten Signale und Botschaften? Was haben sie über den (politischen) Umgang mit Gewalt und Terror gelernt?
New-York-Syndrom
Mit Sicherheit haben die Ereignisse die Affekte der Menschen stark ergriffen. Über Wochen war Angst wohl das dominierende Thema. Wenn schon unter "normalen" Verhältnissen etwa 15 Prozent der Bevölkerung unter behandlungsbedürftigen Angststörungen leiden, dann dürfte der allgemeine Angstpegel stark angestiegen sein. Von der "Angst vor der Angst" schrieb "Die Zeit" und Psychologen erfanden die neue Diagnoseetikette vom "New-York-Syndrom", definiert als ein im Zusammenhang mit dem 11. 9. auftretender Zustand lähmender Angst.
Dass der Terror viele Menschen bis ins Mark getroffen hat, geht aus einer Befragung deutscher Hausärzte hervor. Jeder zweite von mehr als 600 Befragten gibt an, seit dem 11. September vermehrt Patienten mit Angststörungen behandeln zu müssen. Viele Ärzte haben zudem festgestellt, dass Patienten, die ihnen vorher zwar als latent depressiv, aber nie als behandlungsbedürftig erschienen, plötzlich massive Angststörungen entwickeln.
Der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth beobachtet spezifische Angstformen. Durch die Flugzeuganschläge in den USA, die Milzbrandbriefe und den Krieg in Afghanistan sei die konkrete Furcht vieler Menschen vor neuen Attacken "in eine diffuse Angst vor allem Möglichen" umgeschlagen, in eine Form der Angst, gegen die man sich nicht wehren kann. Während sich Furcht mithilfe des Verstandes bekämpfen lässt, ist Angst irrational. "Unser Verstand kann die Angst nicht beseitigen", weiß Roth. Eine besondere Gefahr sieht der Neurowissenschaftler darin, dass das verängstigte Gehirn im Zuge der öffentlichen Alarmierung seine Umgebung ständig nach neuen Quellen absucht. "Zum Schluss hat man vor allem und jedem Angst", fürchtet er.
Wie sehr sind von alledem Kinder betroffen? Hat die intensive mediale Darstellung auch ihre psychische Verarbeitungskapazität überbeansprucht, sodass schwere Traumata ausgelöst worden sind?
Schon bei der Frage, ob und wie Kinder mit dieser grausamen Realität konfrontiert werden können oder sollen und darüber, was Kinder verkraften, gehen die Meinungen auseinander. Laut einer repräsentativen FORSA-Umfrage trauen acht Prozent Prozent der Eltern schon Vierjährigen die TV-Bilder des Anschlags zu, 29 Prozent meinen, Sechsjährige würden das schon verkraften und nahezu jeder zweite (46 Prozent) ist der Ansicht, dass Kinder erst ab zehn Jahren die Bilder sehen sollten.
Ob Kinder tatsächlich Angstsymptome entwickeln hängt von verschiedenen Risikofaktoren ab. Das höchste Traumarisiko haben jüngere Mädchen mit vorbestehenden psychischen Auffälligkeiten. In der kinderpsychologischen Praxis zeigt sich zudem, dass die Kinder ängstlich-nervöser Mütter sowie unverbindlich-wohlmeinender Väter am meisten gefährdet sind und eigene psychische Auffälligkeiten und Stresssymptome das Risiko bei ihren Kindern erhöhen.
Entscheidend sind die subjektiven Bewertungsprozesse der Kinder, insbesondere das während des Ereignisses vom Kind erlebte Ausmaß an Angst und Hilflosigkeit. Bezogen auf die Terrorakte des 11 September kann man allerdings davon ausgehen, dass Kinder heute aufgrund ihrer Vorerfahrungen mit den digitalen Horrorwelten und Brutal-Spielwelten längst abgestumpft sind und wesentlich Schärferes gewohnt sind. Auch der bekannte Kinderpsychiater Max Friedrich meint, dass sie bei der Konfrontation mit realen Katastrophen nichts anderes erfahren, "als die Wiederbelebung von schon durchlebten oder unbewussten Ängsten."
Gefühls-Kränkung
Marianne Leuzinger-Bohleber, Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts, wehrt sich überhaupt dagegen, den Begriff Trauma nach dem 11. September auszuweiten. Ihr Einwand: "Ein eigener körperlicher Anteil am Geschehen ist für eine Traumatisierung absolut notwendig". Und Micha Brumlik fragt: "Was haben wir schon gesehen? Wir haben kein Blut fließen und niemanden sterben sehen!" Die Attacke auf das World Trade Center habe höchstens eine "Kränkung" unserer Gefühlswelt bewirkt. Auch die bekannte deutsche Psychoanalytikerin Alice Miller sieht in der Wirkung der Fernsehbilder der Attentate in den USA und in der Kriegsberichterstattung auf die kindliche Psyche keine Traumagefährdung im eigentlichen Sinn, und zwar deswegen nicht, "weil sie nicht unsere eigene körperliche Existenz bedrohten". Allerdings, schränkt Miller ein, könnten die Geschehnisse bei all jenen, die in der frühen Kindheit geschlagen und gedemütigt worden sind, verdrängte Ängste und traumatische Erfahrungen reaktivieren.
In der Kinderpsychologie sind die spezifischen Symptommuster einer kindlichen Traumatisierung klar umschrieben und als posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) schon seit 1980 in das internationale Diagnosemanual der psychischen Störungen (DSM-III) aufgenommen (siehe Kasten). Ausgehend von den dargelegten Kriterien dürfte nur eine sehr geringe Zahl an Kindern tatsächlich Traumata entwickelt haben. An die Grenze ihrer psychischen Belastbarkeit sind vermutlich nur jene geraten, die schon mit ihrer bisherigen Lebensgeschichte und Alltagserfahrung überfordert waren, oder solche, die - wie Andreas im eingangs skizzierten Fallbeispiel - bereits an einer generellen Angststörung leiden. Wer seelisch ohnehin instabil ist, kann die Zerstörung bisher gültiger Gewissheiten und sozialer Sicherheiten schwer ertragen. Dagegen zeigen Studien (sogar aus Kriegsgebieten) dass Kinder Erfahrungen mit Terror und Gewalt emotional verarbeiten, wenn ihr gewohnter Alltag bestehen bleibt und sie ausreichend soziale Unterstützung in Familie, Kindergarten und Schule erfahren. Wichtig ist, dass sie ihre Ängste so spontan und so naiv wie möglich artikulieren können.
Im Detail: Psychotraumata bei Kindern
Der Autor ist Psychologe und Psychotherapeut in Innsbruck.
* Akute Belastungsreaktion: In den ersten Stunden und Tagen nach einem belastenden Ereignis treten Symptome von Bewusstseinseinengung, Desorientierung und eingeschränkter Aufmerksamkeit verbunden mit Unruhezuständen auf. Symptome klingen meist nach Tagen ab.
* Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS): Folgende Symptome sind gleichzeitig vorhanden und treten während mindestens eines Monats auf:
1. Wiedererleben: Immer wieder werden Bilder vom traumatischen Ereignis durch Erinnerungsreize hervorgerufen und drängen ins Bewusstsein, sei es im Rahmen von Alb- und Tagträumen oder von Flashbacks. Bei jüngeren Kindern ist häufig das sogenannte traumatische Spiel zu beobachten, in welchem die belastende Szene auf zwanghafte Weise immer wieder nachgestellt wird, beispielsweise indem das Kind immer wieder ein Flugzeug in übereinandergestapelte Holzklötze stürzen lässt.
2. Vermeidungsverhalten:
Weil die Symptome des Wiedererlebens quälend sind, versucht das Kind auslösende Reize zu vermeiden. Es entwickelt eine Vielfalt von Vermeidungsstrategien und geht Dingen, Personen, Orten und Gesprächen aus dem Wege, welche an das Trauma erinnern.
3. Körperliche Übererregungszustände: Das Wiedererleben des Traumas sowie der andauernde Versuch, auslösende Reize zu vermeiden, gehen einher mit einer vegetativen Übererregung. Es kommt zu Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen, übermäßiger Wachsamkeit sowie einer erhöhten Reizbarkeit und Schreckhaftigkeit.
H. Z.