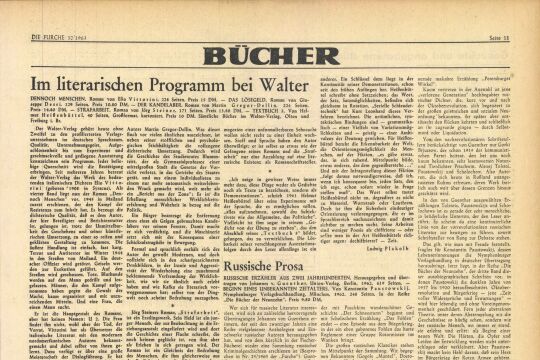Mit unfreundlichen Grüßen!
Was Literatur leisten kann und wie Intellektuelle in Russland (über)leben, zeigt Oleg Jurjews Roman "Unbekannte Briefe" - auf meisterhafte und pointenreiche Art und Weise.
Was Literatur leisten kann und wie Intellektuelle in Russland (über)leben, zeigt Oleg Jurjews Roman "Unbekannte Briefe" - auf meisterhafte und pointenreiche Art und Weise.
Bei dem vorliegenden Band des russischen Autors Oleg Jurjew handelt es sich um eine Sonderform des Briefromanes. Es wird kein Briefwechsel geboten, sondern drei fiktive Briefe, eingeleitet jeweils von einem Herausgeber, der sich ebenfalls Oleg Jurjew nennt. Die fiktive Post stammt von Leonid Dobytschin, einem gewissen Iwan Pryschow und Jakob Michael Reinhold Lenz und richtet sich an Kornei Tschukowski, Fjodor Dostojewski und Nikolai Karamsin. Damit ist das Feld bezeichnet, auf das der reale russische Autor Oleg Jurjew seine Figuren gesetzt hat. Literaturgeschichte wird hier noch einmal literarisiert - und das auf eine äußerst geistreiche und daher auch unterhaltsame Art und Weise.
Beginnen wir also mit den ersten Spielzügen. Leonid Dobytschin, ein sowjetischer Autor der Avantgarde, den deutschen Lesern durch seinen Roman "Die Stadt N." bekannt, schreibt an den, in der Sowjetunion von jedermann hoch verehrten Literaturkritiker, Übersetzer und Kinderbuchautor Kornei Tschukowski (1882-1969). Der Brief wird am 19. Juni 1954 begonnen, das letzte Postskriptum datiert genau vierzig Jahre später vom 19. Juni 1994. Die erste Pointe besteht darin, dass der reale Adressat zu diesem Zeitpunkt schon ein Vierteljahrhundert tot ist, die zweite, dass Dobytschin mit ziemlicher Sicherheit das Jahr 1936 nicht überlebt hat. Entweder wurde er als "Formalist" verhaftet und erschossen oder (und das ist die wahrscheinlichere Variante) er wählte im Wissen um ein unabwendbares Schicksal den Freitod. Da man seine Leiche nie gefunden hat, galt er lange Zeit als "verschwunden".
Gespickt mit Groteskem
Bei Jurjew aber lebt Dobytschin als Wirtschaftsstatistiker in einer Sowchose bei Leningrad weiter und wird so zu der Modellfigur eines sich in den Alltag zurückziehenden Intellektuellen, der mit originellem Räsonnement das literarische Leben der Sowjetunion begleitet. Da er in dem Schweinemastbetrieb, in dem er arbeitet, nur schwer die richtigen Gesprächspartner findet, kommt Kornei Tschukowski ins Spiel. Dem hochverehrten Bekannten aus literarisch aktiven Zeiten wird hier brieflich alles in äußerst respektvoller Form vorgelegt: Dobytschins Reaktion auf die (im direkten Wortsinn) vernichtende Kritik seiner Arbeiten, er fragt nach dem Verbleib gemeinsamer Kollegen und Freunde (sie wurden erschossen, starben in der Haft oder verhungerten, wie etwa Daniil Charms), die Reaktionen auf Stalins Tod 1953, das Erscheinen von Solschenizyns "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch", der Prozess gegen Joseph Brodsky und vieles mehr. Kein Absatz, kein Postscriptum ohne literarische Anspielungen, alles verpackt im sprachlichen Habitus der Zeit und gespickt mit grotesken Berichten über Begebenheiten in dem Schweinemastbetrieb am Leningrader Stadtrand.
Oleg Jurjew gelingt es, den unterschiedlichen Etappen die charakteristischen Wendungen abzuhören. Das Kauderwelsch aus Dialektischem Materialismus und echter Gemeinheit wird als der verbrecherische Unfug vorgeführt, der es immer schon war. Da ist es auch egal, wenn man als Leser nicht sofort weiß, wo eigentlich der Ort Ekibastus liegt, in den der fiktive Dobytschin nach dem Krieg nicht ganz freiwillig geschickt wurde (Ekibastus liegt im Norden Kasachstans) und in dem auch Solschenizyn seine Lagerhaft abgesessen hat.
"An wen wohl? An Gott?"
Die beiden weiteren Briefe folgen dem Grundschema des ersten. Immer ist es ein Autor, der (aus sehr unterschiedlichen Gründen) nicht reüssieren kann, eine verzweifelte Existenz, die sich an einen arrivierten Kollegen mit der Frage wendet: Wie konnte das passieren? Wie konnten wir so werden, wie wir geworden sind? Im zweiten Brief meldet sich die vermeintliche Vorlage für eine Nebenfigur in Dostojewskis Roman "Die Dämonen" zu Wort, im dritten schreibt Jakob Michael Reinhold Lenz an den bedeutenden russischen Historiker Nikolai Karamsin. In dem "Vorwort des Herausgebers" zum dritten Brief (Lenz an Karamsin) kommt zu guter Letzt auch der gemeinsame Fluchtpunkt dieser Episteln ins Spiel: Die Anrufung einer schweigenden Autorität meint natürlich immer auch den Schöpfer selbst und so - und wieder in einer literarischen Verkleidung, über die hier aber nichts verraten wird -richten sich diese Briefen alle auch "An wen wohl? An Gott? - Noch besser wäre es selbstverständlich, wenn ein Brief von Gott . auftauchen würde, aber damit rechne ich (d. i. der fiktive Herausgeber, Anmerkung: G. D.) nur in geringem Maße."
Der letzte Brief dieser Sammlung stammt vom Autor der Stücke "Der Hofmeister" und "Die Soldaten". Jakob Michael Lenz wurde am 24. Mai 1792 auf einer Moskauer Straße tot aufgefunden. Die näheren Umstände seines Todes sind unbekannt, es gibt kein Grab, keine Dokumente. Der von Lenz überlieferte Ausruf: "Wäre doch die Moskwa der Rhein!" lässt aber vermuten, dass ihm auch die letzte Station seiner unruhigen Lebensreise nicht die Sicherheit geboten hat, die ihm so dringend notwendig gewesen wäre. Jurjew datiert das fiktive Schreiben an Karamsin auf den 23. Mai 1792, also auf den Tag vor Lenzens Tod: In Moskau finden Hausdurchsuchungen statt. Katharina II., durch die Französische Revolution alarmiert, fürchtet, die russischen Freimaurer könnten ihrem Thron gefährlich werden. Lenz war tatsächlich in deren, in Moskau allerdings rein philanthropische Tätigkeiten involviert. Der ewig unglückliche Projektemacher hatte zudem der Kaiserin in einem Schreiben vorgeschlagen, die unnütz im Kreml herumstehende Zarenkanone (man kann die Kanone heute noch bestaunen) umzugießen und das Metall für Druckmaschinen zur Verbreitung aufklärerischer Schriften zu verwenden! Eine Eselei, die ihm in Moskau möglicherweise das Leben kostete.
Mit Leben füllen
Von diesem Roman in drei Teilen ist der mittlere (der Brief des Mörders und alkoholkranken Gelegenheitsschriftstellers Pryschow an Fjodor Dostojewski) wohl der schwierigste. Die Abrechnung ist grausam und fordert auch dem Leser einiges ab. Dass Dostojewski, ständig in Geld- und Existenznot, sein Schriftstellerhandwerk ziemlich rücksichtslos betrieben hat, ist bekannt, seine antisemitischen und xenophoben Einlassungen, vor allem in seinen heute fast vergessenen politischen Schriften, sind gottlob nur mehr Lektüre für Dostojewski-Forscher. Dass ein russisches Sittenbild ohne diese schwarzen Flecken nicht komplett wäre, ist aber leider auch richtig.
Es wird oft geklagt, dass man über das wahre Leben in Russland zu wenig weiß und auch wenig zu lesen bekommt. Der Hinweis auf die neueste Putin-Biografie macht da nicht glücklich und die politischen Analysen bieten Daten und Fakten, die sich für den Laien aber nur selten mit Leben füllen. Oleg Jurjew führt hier vor, was Literatur leisten kann. Der Roman zeigt, wie Intellektuelle in Russland (über)leben, was ihnen dabei widerfährt und welche Strategien ihnen zur Verfügung stehen. Der Autor, 1959 in Leningrad geboren, lebt seit 1991 in Deutschland und hat das Buch auf Deutsch verfasst. Er ist Lyriker, Übersetzer und Literaturwissenschaftler; in diesem Roman erweist er sich als meisterhafter Prosaist. Er ist - wie Joseph Conrad oder Vladimir Nabokov - immer Autor und Übersetzer aus einer fremden Kultur zugleich: Wer wirklich etwas über Russland erfahren will, in den "Unbekannten Briefen" von Oleg Jurjew wird auch der Fachmann noch fündig.
Unbekannte Briefe
Roman von Oleg Jurjew
Verbrecher Verlag 2017
293 S., geb., € 22,70