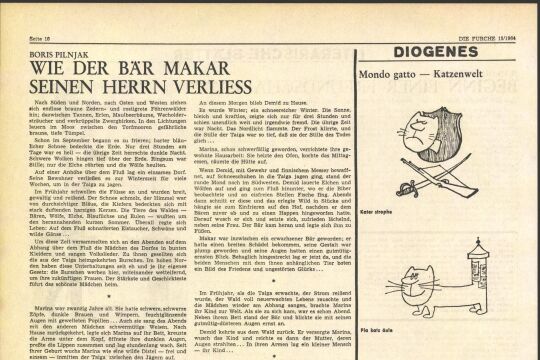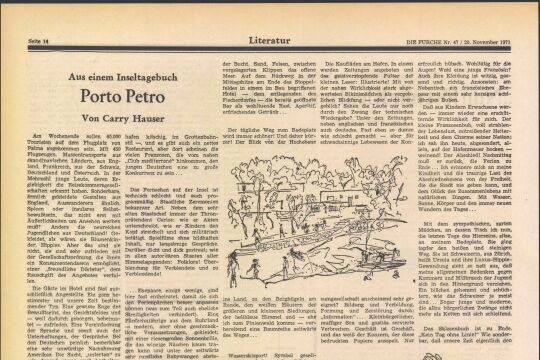Schlimme Bären landen manchmal im Gefängnis
Tief im arktischen Gebiet Kanadas, in der kleinen Stadt Churchill, müssen die 1.000 Einwohner ihr Leben mit 200 gefährlichen Polarbären teilen.
Tief im arktischen Gebiet Kanadas, in der kleinen Stadt Churchill, müssen die 1.000 Einwohner ihr Leben mit 200 gefährlichen Polarbären teilen.
675-2327 ist die wichtigste Telefonummer von Churchill. Jeder der nur 1.000 Einwohner kennt sie auswendig. Aber auch viele Touristen. Schließlich steht sie auch auf vielen Warnschildern rund um die kleine Stadt an der Hudson Bay. Der Anschluß ist Tag und Nacht besetzt. Er ist wichtiger als Polizei, Rettung und Feuerwehr. 675-2327 ist die Nummer der "Polar Bear Police", die es nur in Churchill, Manitoba, im Nordosten Kanadas gibt.
Churchill ist die Hauptstadt der Polarbären. Jedes Jahr im November müssen sich die nicht einmal 1.000 Bewohner ihren Lebensraum mit 200 Eisbären teilen. Das kann mitunter auch gefährlich sein. Polarbären zählen, so putzig und tolpatschig sie auch aussehen mögen, zu den gefährlichsten Raubtieren der Welt. Schnell, stark und unberechenbar, greifen sie ohne Vorwarnung an.
Mit Frontiers North sind wir am frühen Morgen mit einem kleinen Flugzeug von Winnipeg nach Churchill gekommen. Das 1717 von der berühmten Hudson Bay Company gegründete Churchill liegt etwas abseits. Mit dem Flugzeug sind es 600 Kilometer, mit der Eisenbahn gar 1.600 Kilometer und 26 lange Stunden bis zur nächsten größeren menschlichen Ansiedlung. Straße gibt es keine, sie endet 350 Kilometer südlich bei Gillam. Obwohl Churchill nur auf 59 Grad nördlicher Breite, ähnlich wie Oslo, liegt, sind wir bereits tief im arktisch polaren Gebiet, im Land des Permafrostes. Hier an der Hudson Bay gibt es keinen wärmenden Golfstrom. Der Winter dauert von Oktober/November bis Juli.
Abenteuer-Touristen aus aller Welt kommen an den Polarkreis, um ein einzigartiges Naturschauspiel zu sehen: Hunderte Eisbären warten, bis die Hudson Bay zufriert. Sie haben "gelernt", daß die Hudson Bay um Churchill am frühesten zufriert. In Churchill warten sie, bis sie auf dem Eis wieder Robben, ihre bevorzugte Mahlzeit, jagen können. Im Sommer hatten sie in der Tundra hungern müssen, ab November streunen sie um Churchill und warten.
Das macht sie auch so gefährlich. Denise, unsere Führerin, warnt mich gleich, als ich bei einem Warnschild "Polar Bear Alert - Stop, don't walk in this aera - Gehen sie nicht in dieser Gegend" ein Erinnerungsfoto machen will. Das Schild steht am Rande des Ortes, vor einigen Felsen. Dahinter die langsam zufrierende Bay. "This is no good idea! Das ist keine gute Idee!", holt sie mich zurück. Zweimal habe sie selbst schon plötzlich einen Bären hinter diesen Felsen auftauchen sehen.
Was man in diesem Fall tun soll, frage ich. Sich ausziehen und langsam rückwärts gehen, lacht sie. Bären sind von Natur aus neugierig. Sie bleiben bei jedem Kleidungsstück stehen und beschnuppern es. Man darf nur nicht davonlaufen und soll ihnen auch nicht direkt in die Augen sehen. Das reizt sie. Lieber frierend bis zum nächsten Haus zurück weichen. In Churchill sollen für diesen Fall alle Haustüren immer offen stehen.
Als ich bei unserer Unterkunft, dem Aurora Inn, die Hintertüre probiere, ist sie aber geschlossen. Der Bär war schon gestern da, "beruhigt" Gavin Lawrie, der Pächter. Und wirklich, direkt vor unserem Fenster sehen wir Bärenspuren. Mächtige Abdrucke, zwei, drei Handteller groß. Ein Polarbär kann zweieinhalb bis drei Meter groß und bis zu 600 Kilogramm schwer werden.
Ein Bär im Gefängnis Der Bär von gestern ist aber bereits im Polar Bear Compound, im Eisbär-Gefängnis. Das gibt es wirklich. Wer innerhalb der Sperrzone des Orts einen Bären sieht, alarmiert sofort die Polarbären-Polizei. 675-2327, das ist das Telefon von Wade Roberts. Die Ranger von den Natural Resources stellen den eingedrungenen Bären und betäuben ihn mit einem Narkosegewehr. Der schlafende weiße Riese wird im etwas außerhalb des Ortszentrums gelegenen Eisbär-Gefängnis zwischengelagert.
Als wir ankommen, werden gerade zwei Polarbären eingeliefert. 32 Bären können hier untergebracht werden. Ist der Jail voll, werden sie 20, 30 Meilen nördlich ausgeflogen. Die Bären erhalten Ohrmarken, damit man sie wiedererkennen kann. Bären, die viermal eingefangen werden, gelten als "unverbesserlich". Sie haben sich an die menschliche Siedlung gewöhnt, sind somit eine Gefahr und werden an Zoos in aller Welt verkauft. Im vergangenen Jahr haben Roberts und seine Ranger 108 Bären gefangen und wieder ausgesetzt. Rund um die kleine Stadt stehen auch ein Dutzend Eisbärfallen. Falls sich die Polarbären zu nahe an den Ort wagen, sollen sie sich hier selbst fangen. Denise hält uns aber davon ab, eine Falle zu besichtigen. Es könnte ein zweiter Bär in der Nähe sein.
Am nächsten Morgen fahren wir mit Debra Wazney in ihrem Tundra- Buggy, einem umgebauten Autobus mit riesigen breiten Rädern, zum Wapusk Nationalpark, in die öde baumlose und platte Tundra. Früher haben hier die GIs den Krieg geprobt. Die Gegend ähnelt Sibirien. Unseren ersten Bären hätten wir fast übersehen. Er schläft faul auf dem gefrorenen Boden des Permafrostes. Die eisige Temperatur scheint ihm nichts anhaben zu können. Sein dichtes weißes Fell sammelt die wenigen Sonnenstrahlen und führt sie direkt zur schwarzen (!) Haut. Ein fünf bis zehn Zentimeter dicke Fettschicht schützt vor jeder Witterung. Eisbären können deshalb auch 200 bis 300 Kilometer im eisigen Polarmeer schwimmen.
"Ursus maritimus - Seebär" nennt sie deshalb die Wissenschaft, "Lazy bears" die Einheimischen. Die Bären müssen sich nun schonen. Bevor sie wieder Robben fangen können, verlieren sie täglich ein Kilogramm an Gewicht. Faul räkeln sie sich in der spärlichen Sonne, während wir uns die Wollmützen tiefer über die Ohren ziehen und in den propangasgeheizten Wagen zurück flüchten. Es weht ein strenger Nordwestwind, der uns die minus fünf Grad wie minus 20 Grad spüren läßt.
Aussteigen wäre nun aber tödlich. Wir werden auch ermahnt, weder Arm noch Fotoapparat über die offene Plattform des Wagens hängen zu lassen. Die Bären sind viel schneller und stärker als ihr, warnt uns Debra. Ein Polarbär kann, obwohl er meist nur langsam und beschaulich schlendert, bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell sein. Und mit nur einem Hieb seiner mächtigen Pranke kann er töten. Füttern ist deshalb gesetzlich strengstens verboten. Es würde nicht nur die Tiere an den Menschen gewöhnen, sondern sie auch aggressiv auf Beute machen.
Die Nase als Waffe In einem etwas kleineren Buggy vor uns fürchten sie sich schon. Einer der riesigen Polarbären hat sich aufgerichtet und schnuppert am Wagen. Mit seinem Maul reicht er problemlos bis zum spaltbreit geöffneten Fenster. Die mutigen "Polarsafari-Abenteurer" weichen entsetzt zurück, doch der Bär riecht nur. Seine Nase ist seine wichtigste "Waffe". Mit ihr kann er Robben selbst durch ein Meter dickes Eis riechen. Bei uns locken ihn die verführerischen Düfte der "vegetable soup", die uns die Kälte erträglicher macht. Die Bären sind völlig lautlos, sie brüllen und pfauchen nicht. Sie sollen auch leise töten, meint Debra.
Am zweiten Tag unserer Tundra-Buggy-Tour lieben uns die Bären. Erst zeigen uns zwei "Males" minutenlang einen beeindruckenden Ringkampf. Dabei spielen sie nur. Jeder könnte den anderen ohne Schwierigkeiten töten. Sie kommen ganz nahe. Mit unseren Teleobjektiven können wir ihre scharfen Zähne und Krallen beobachten. Und dann sehen wir noch eine "Female" mit ihren zwei "Cubs", etwa zehn Monate alt. Sie haben einen Vogel erlegt und kauen die Federn. Als sich aber ein männlicher Bär nähert, bringt die Mutter ihre Jungen rasch in Sicherheit.
Am Weg zurück sehen wir noch, wie die Bären aus dem Polar Bear Compound ausgeflogen werden. Wie tot hängen sie im Netz unter dem Helikopter, der sie zurück in die Tundra bringt. Hoffentlich wachen sie nicht auf, bevor sie in die Freiheit entlassen werden.