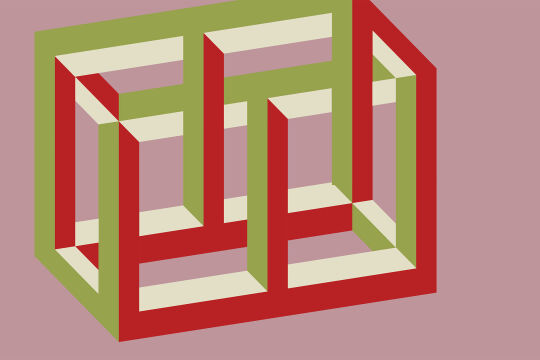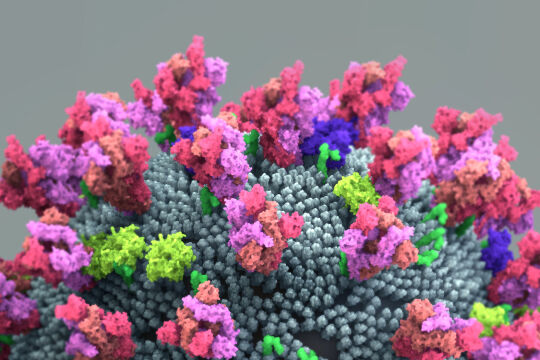Lange, sehr lange Zeit haben Ärzte den Patienten mehr geschadet als genutzt. Diese These vertritt David Wootton in seinem Buch "Bad Medicine" und im Furche-Gespräch.
Wie viel Gutes, wie viel Schlechtes hat die Medizin dem Menschen getan? Und hätten gewisse medizinische Fortschritte nicht früher stattfinden sollen? Für einen Wissenschaftshistoriker stellt David Wootton ungewöhnliche Fragen. Im Furche-Interview spricht der Professor von der Universität York über verpasste Chancen und warum es keine Medizin geben kann, die ganz auf den Einzelnen zugeschnitten ist.
Die Furche: Herr Professor Wootton, in Ihrem Buch "Bad Medicine" vertreten Sie eine provokante These: Die Medizin soll bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts mehr geschadet als genutzt haben.
David Wootton: Lassen Sie mich das präzisieren: Ich bezweifle, dass die Medizin mehr Gutes als Schlechtes getan hat bis zur Entdeckung von Penicillin. Das war in den 1920er Jahren. Ganz sicher lässt sich das aber für die Zeit vor 1850 sagen.
Die Furche: Aber es gab doch bereits viel früher gewaltige Fortschritte. Im 16. Jahrhundert haben Anatomisten wie Vesalius den menschlichen Körper genau studiert und exakt beschrieben; William Harvey hat dann herausgefunden, wie das Blut im Körper zirkuliert …
Wootton: Harveys Entdeckung ist ein besonders schönes Beispiel dafür, dass man zwar etwas theoretisch verstanden hatte, das aber keine Auswirkung auf die Praxis hatte. Erst rund 80 Jahre später wurde das Tourniquet (Anm. eine zum Abbinden von Gliedmaßen verwendete Schlauchbinde) bei Amputationen eingesetzt.
Die Furche: Warum ließ diese Anwendung so lange auf sich warten?
Wootton: Es ist rätselhaft. Es war bekannt, dass viele Leute bei Amputationen verstarben. Aber irgendwie hatte man die Natur des Problems nicht ganz erfasst.
Die Furche: Heute sind wir natürlich gescheiter. Wie fair ist es da, ein Urteil über die Vergangenheit zu fällen?
Wootton: Das ist keine leichte Frage. Wir sollten nicht annehmen, dass nur weil wir jetzt klarer sehen, die Menschen es damals auch hätten sehen müssen. Aber es gibt viele Fälle, in denen auch Forscher rückblickend sagten: Das hätten wir erkennen müssen. Das wäre nicht schwierig gewesen.
Die Furche: Können Sie ein Beispiel nennen?
Wootton: John Tyndall, der selbst über Krankheitskeime forschte, lamentierte um 1870, dass bereits 30 Jahre zuvor Schwann eine eindeutige Verbindung zwischen dem Fäulnisprozess und mikrobiellem Leben hergestellt habe und dass erst jetzt damit begonnen werde, bei chirurgischen Eingriffen antiseptisch zu arbeiten. Übrigens eine Idee von John Lister, der damit die Todesrate nach Amputationen von 45 auf 15 Prozent senken konnte. Irritierend ist auch die Geschichte der Betäubungsmittel. Die wurden zunächst bei Pferden eingesetzt, nicht aber bei Menschen. Offensichtlich weil man nicht daran dachte, dass es wichtig wäre Schmerz zu verhindern. Da gibt es eine Lücke von 15 Jahren. Das ist nicht sehr lange, aber signifikant. Da muss man sich doch fragen: Wie konnten wir so grausam sein?
Die Furche: War der Fortschritt vielleicht langsamer, weil frühere Gesellschaften ganz allgemein viel statischer waren?
Wootton: Das ist eine komplizierte Sache. Bis zirka 1914 - dem Beginn des ersten Weltkriegs - lebten die Menschen in traditionellen Gesellschaften, die von Autoritäten wie dem Kaiser oder der Kirche geprägt waren. Veränderungen galten da als suspekt. Auch deshalb konnte die Medizin von Galen und Hippokrates bis ins späte 19. Jahrhundert überdauern, und das obwohl diese traditionellen Therapien oft unwirksam, wenn nicht gar schädlich waren. Heute leben wir hingegen in einer Zeit, die Veränderung absolut gutheißt. Ja, es gibt fast eine irrationale Begeisterung für Veränderung. Deshalb sind die Hürden für Innovationen viel niedriger.
Die Furche: Das klingt plausibel. Als entscheidenden Schritt hin zu einer modernen Medizin werten Sie die Fähigkeit, statistische Vergleiche zu ziehen.
Wootton: Und auch hier gibt es einige Vorläufer. Der bekannteste, aber nicht der erste ist der Schiffsarzt James Lind. Mitte des 18. Jahrhunderts behandelt er Matrosen, die an Skorbut leiden, indem er sie in Gruppen aufteilt und mit verschiedenen Diäten versorgt. Jene, die Organen und Zitronen bekommen, werden schnell wieder gesund. Leider geht seine Erkenntnis bald verloren; ebenso wie seine Art, den Erfolg von Therapien zu messen. Diese Methode erlebt erst im 20. Jahrhundert ihren Durchbruch.
Die Furche: … in Form von randomisierten klinischen Studien. Trotzdem gibt es alternative Heilmethoden, die den Wert solcher statistischer Untersuchungen anzweifeln. Etwa die Homöopathie, die behauptet, eine ganz auf den Einzelnen zugeschnittene Therapie anzubieten - und die in ihrem Buch überraschend gut wegkommt.
Wootton: Zu Beginn war die Homöopathie eine bessere Medizin als die traditionelle. Die großen Verdünnungen haben nahezu nie geschadet und als Placebo haben die Mittelchen vielleicht sogar zur Genesung beigetragen. Was die Idee einer individuellen Behandlung betrifft: Da existiert ein großer Denkfehler. Ein Doktor behandelt nicht Erika Müller. Ein Doktor behandelt immer eine Krankheit, etwa Tuberkulose. Folglich werden immer Gruppen behandelt: an Tuberkulose Erkrankte. Der Heilerfolg lässt sich also durch Vergleich messen. Eine ganz persönliche Behandlung kann es nicht geben. Wie der Arzt mit dem Patienten dabei umgeht, ist eine andere Frage. Aber auch Interview-Techniken lassen sich lernen.
Die Furche: Sie haben gefordert, dass mehr Gelder für die Homöopathie bereitgestellt werden. Warum eigentlich?
Wootton: Ich glaube, dass sich die Placebo-Wirkung sinnvoll und noch gezielter einsetzen lässt. Doch inzwischen hat die NHS (Anm. britische Gesundheitsbehörde) auch die Homöopathie als Heilmethode anerkannt. Um das Fach zu professionalisieren, wurden eigene universitäre Studiengänge eingerichtet, die einen Bachelor in Homöopathie vergeben. Das ist doch Wahnsinn. Selbst wenn die Homöopathie kaum schadet, bin ich da dagegen - weil es irrige Glaubensvorstellungen fördert.
Die Furche: Eine letzte Frage: Wenn sich wichtige Entdeckungen immer wieder verzögert haben, warum sollte dies heute nicht immer noch so sein? Oder anders formuliert: Welche Chancen verpassen wir zurzeit gerade?
Wootton: Zum Beispiel glaube ich, dass wir nicht wissen, wie wir mit Suchtverhalten umgehen sollen. Eine Folge davon ist Kriminalität, mit der Suchtkranke ihren Konsum finanzieren. Deshalb geben wir viel Geld für Überwachungskameras, Polizeiautos und Gefängnisse aus. Innovative therapeutische Ansätze oder vergleichende Studien fehlen hingegen. Das Ganze erinnert stark an die Medizin des 19. Jahrhunderts: Obwohl es nicht gut funktioniert, machen wir trotzdem damit weiter. In hundert Jahren werden die Menschen deshalb wohl über unsere Armut an Ideen überrascht sein. Schließlich wurden die sozialen Probleme klar identifiziert, aber eben nicht ernsthaft genug in Angriff genommen.
Das Gespräch führte Thomas Mündle.
David Wootton lehrte die vergangenen zwei Wochen an der Vienna Summer University 2008, einer hochkarätigen Veranstaltung über Wissenschaftsphilosophie, die alle zwei Jahre vom Institut Wiener Kreis organisiert wird.