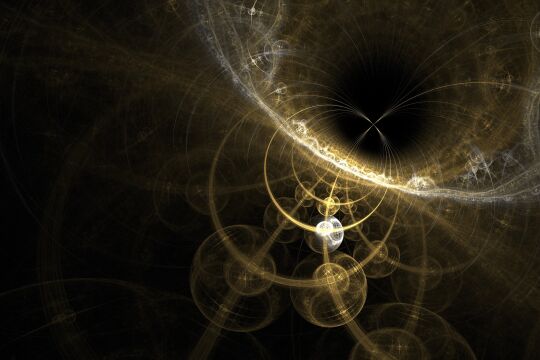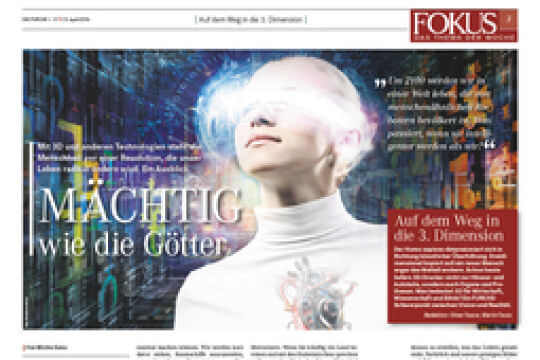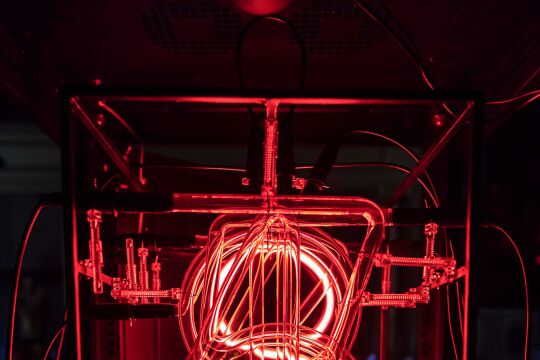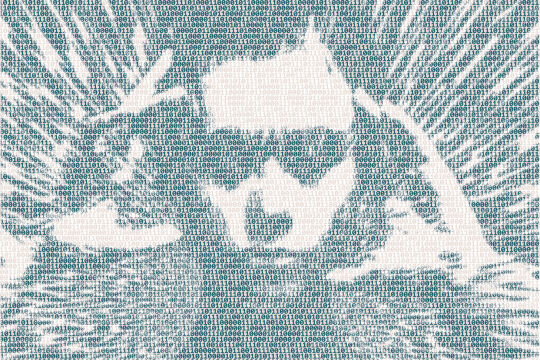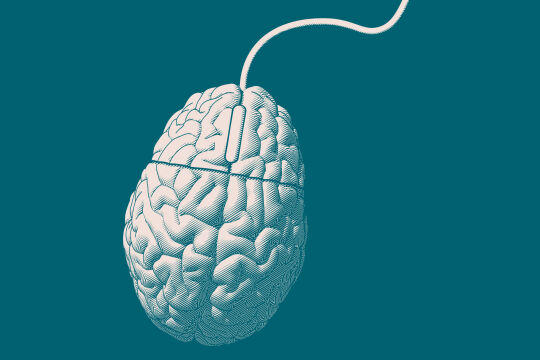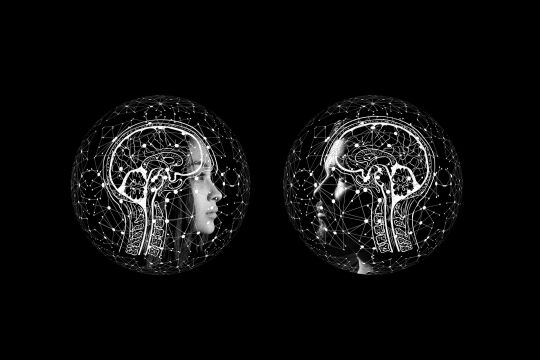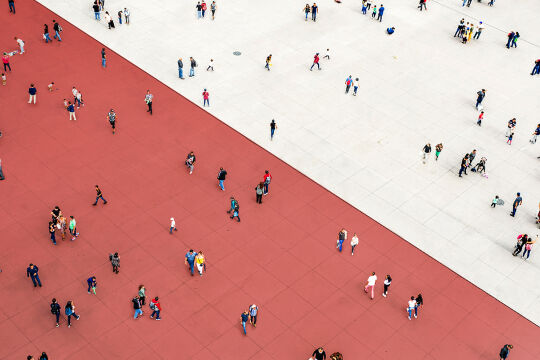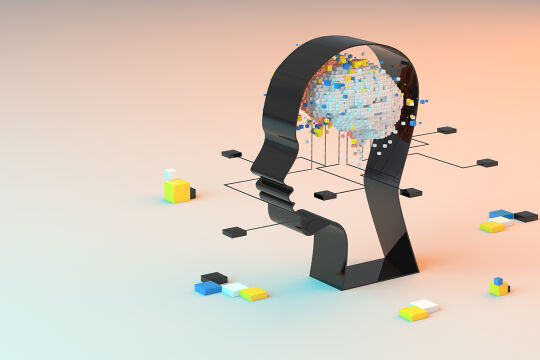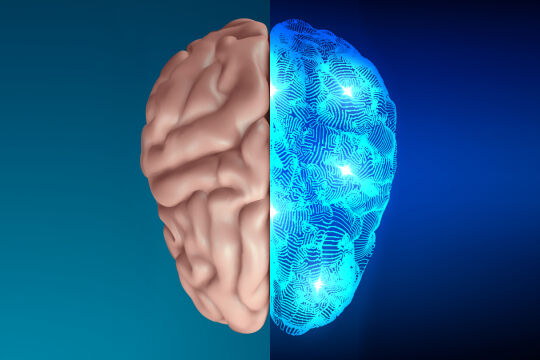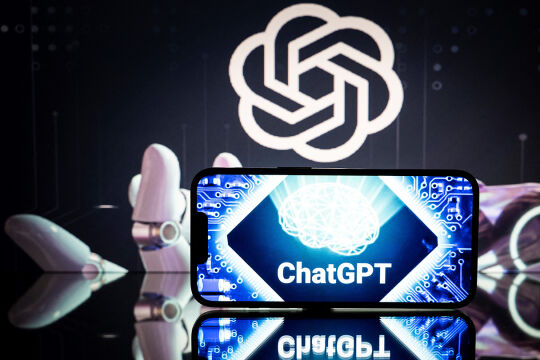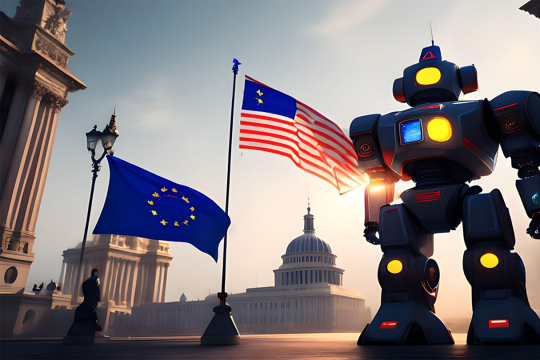Künstliche Intelligenz: Grüner Datenstrom
Künstliche Intelligenz ist ein Energiefresser, weckt aber auch große Hoffnungen für den Klima- und Umweltschutz.
Künstliche Intelligenz ist ein Energiefresser, weckt aber auch große Hoffnungen für den Klima- und Umweltschutz.
Als Ivona Brandic begann, zu Künstlicher Intelligenz (KI) zu forschen, sorgte sich die Öffentlichkeit um wild gewordene Killerroboter, die ein algorithmisches Eigenleben entwickeln und die Menschheit unterjochen. Brandics Antwort damals: „Bevor das passiert, wird uns eher der Strom ausgehen.“ Sechs Jahre sind seither vergangen, die Informatikerin arbeitet als Professorin für „High Performance Computing Systems“ an der Technischen Uni Wien, und das EU-Parlament hat mit dem „AI-Act“ letzte Woche das erste umfassende KI-Gesetz auf den Weg gebracht. Dadurch sollen die Gefahren der Künstlichen Intelligenz durch strenge Regulierung und auch Verbote – zum Beispiel für Verhaltensklassifizierung oder Gesichtserkennung im öffentlichen Raum – eingedämmt werden. Die neuen Regeln werden aber voraussichtlich frühestens 2026 in Kraft treten.
Präzisere Prognosen
Womit Ivona Brandic jedenfalls recht behalten sollte: Killerroboter sind derzeit nicht das große Problem; die Energiefrage schon eher. Mit Blick auf Energieknappheit sowie Umwelt- und Klimakrise lasten große Erwartungen auf KI-Anwendungen. Sie sollen Industrieprozesse effizienter, emissionsärmer und energiesparender gestalten, Frühwarnsysteme verbessern, Prognosen präzisieren und Umweltschäden zuverlässiger erkennen. Gleichzeitig sind die Emissionen, die KI-Systeme verursachen, enorm. Allein die Entwicklung von GPT-3, der KI hinter ChatGPT, benötigte rund 550 Tonnen CO₂-Äquivalente, so viel wie 66 Durchschnittsösterreicher(innen) pro Jahr. Schaden KI-Anwendungen Umwelt und Klima am Ende gar mehr, als sie zu deren Schutz beitragen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!