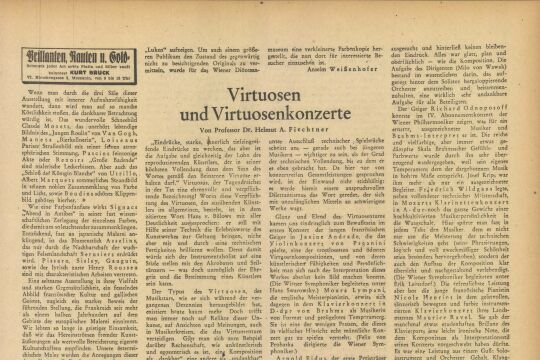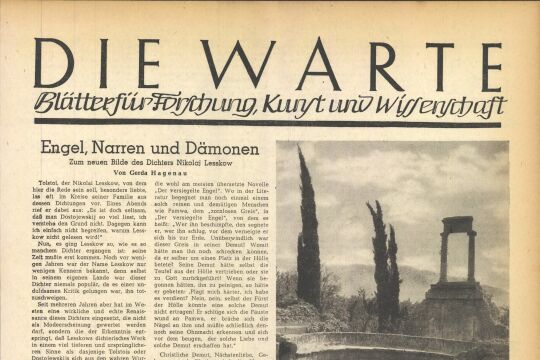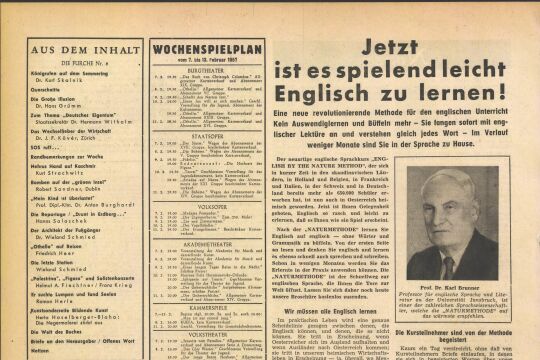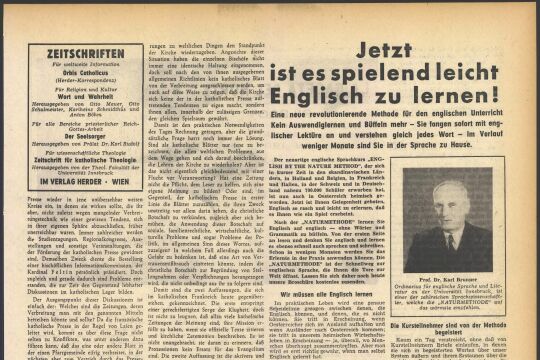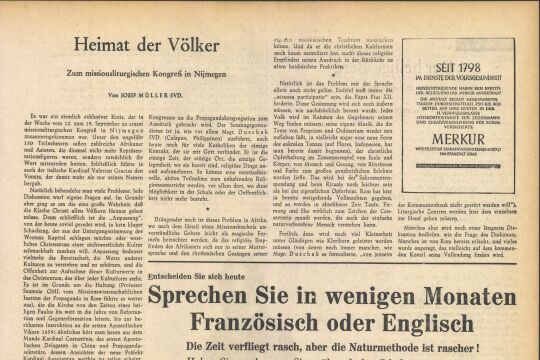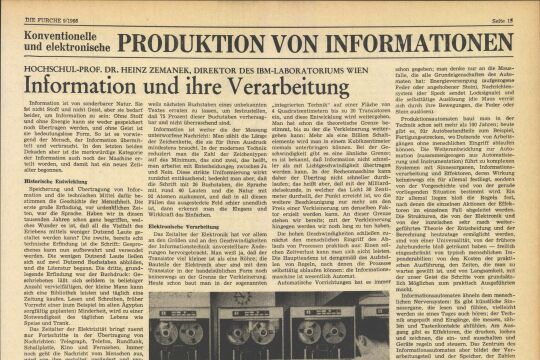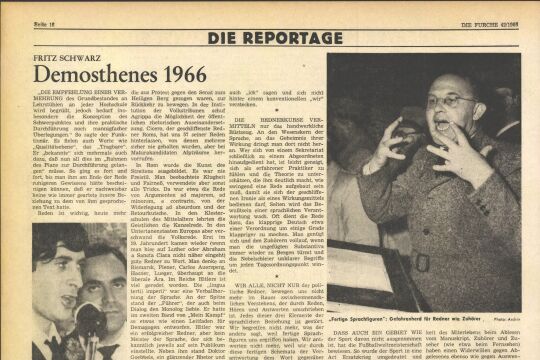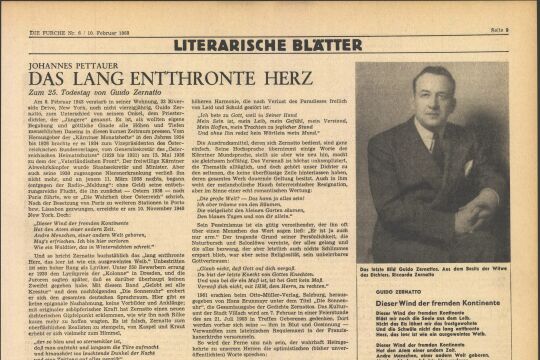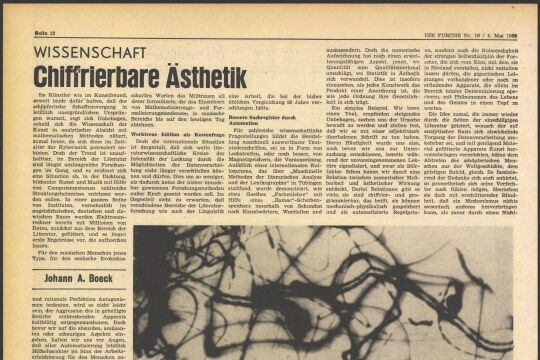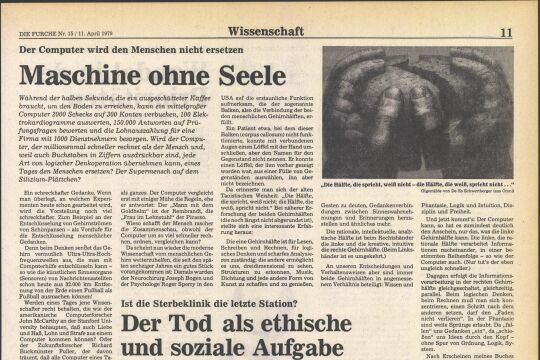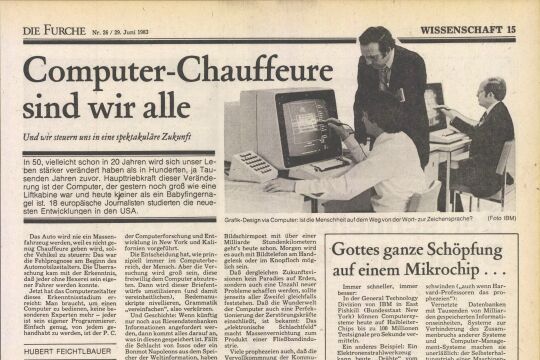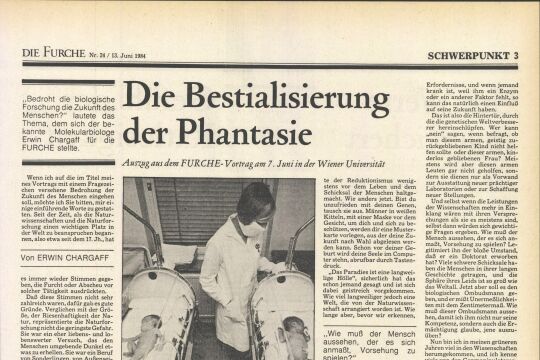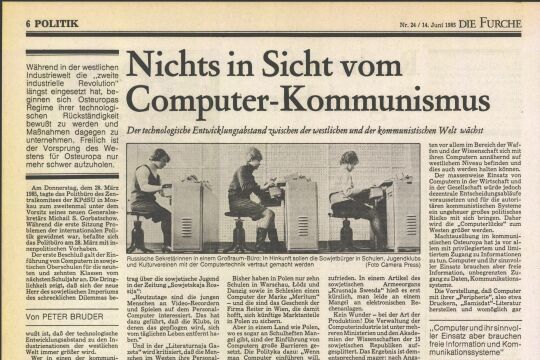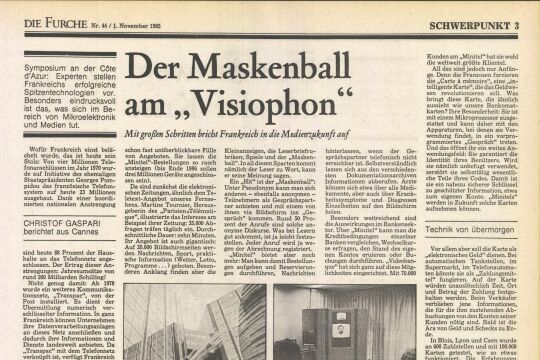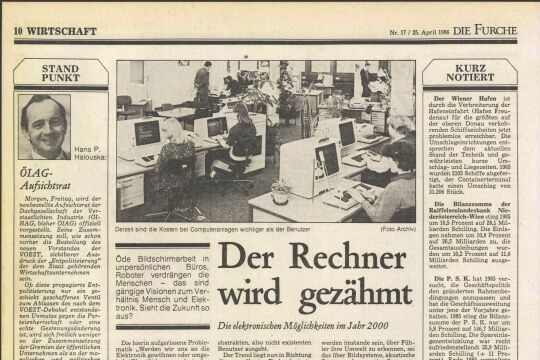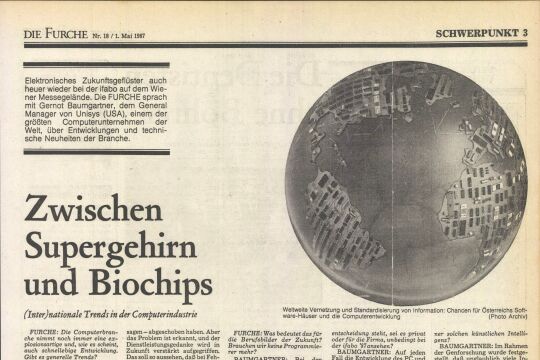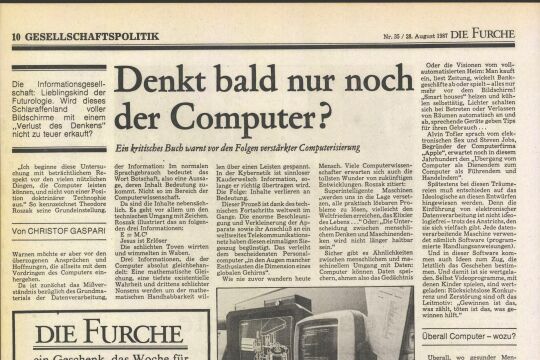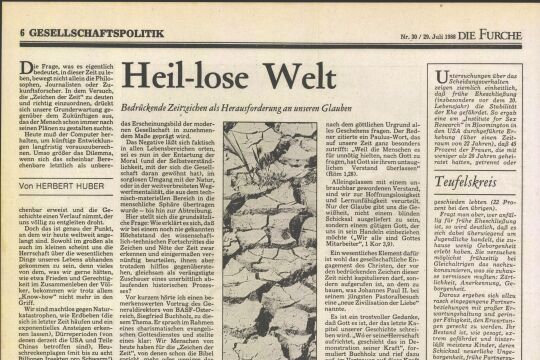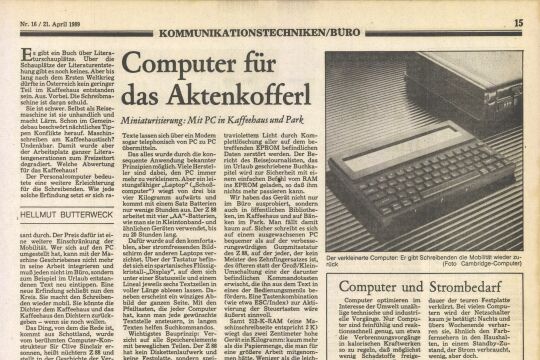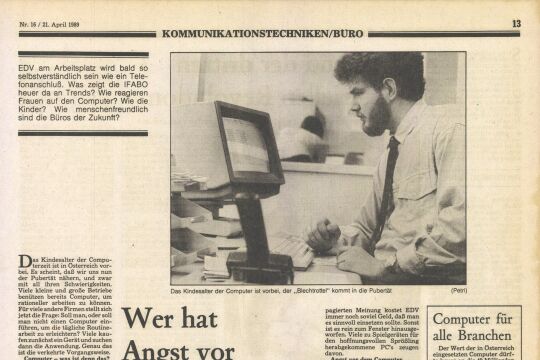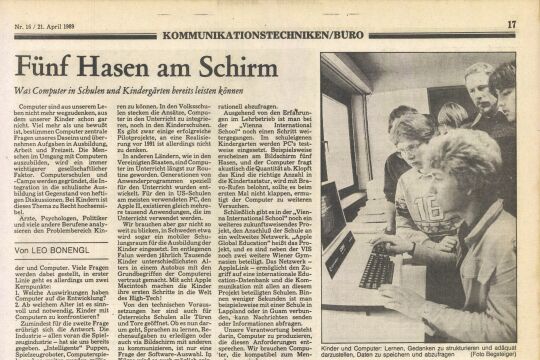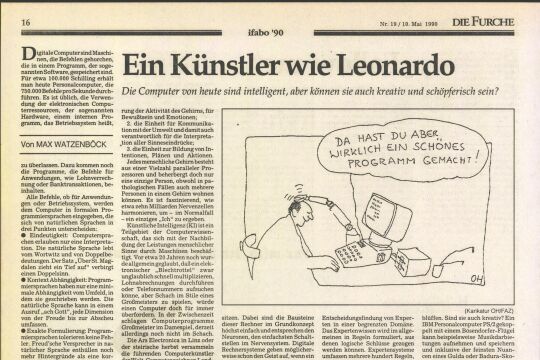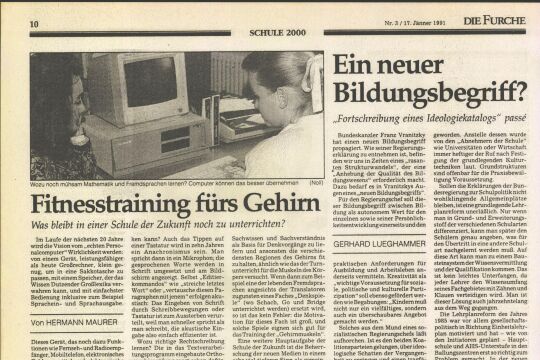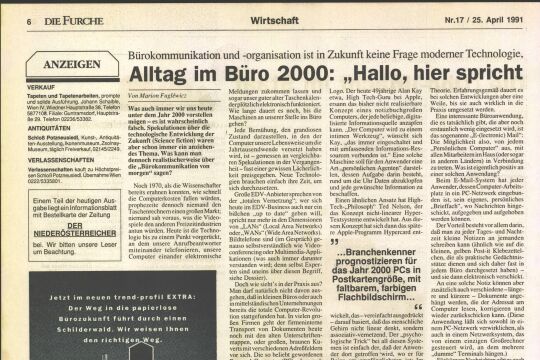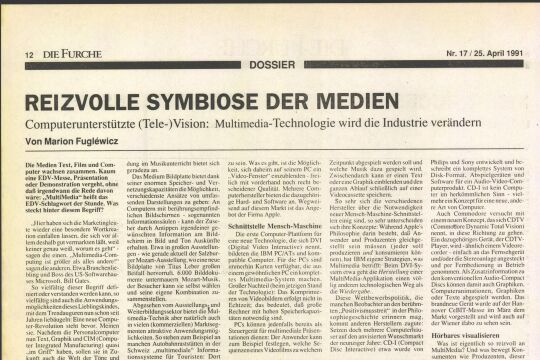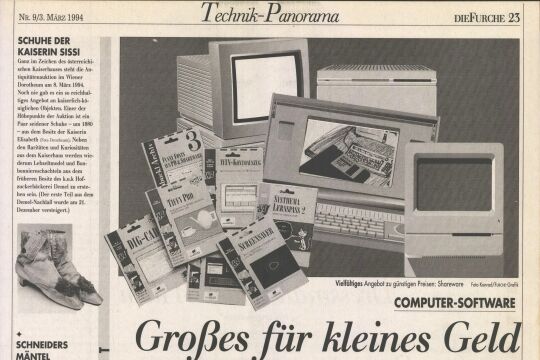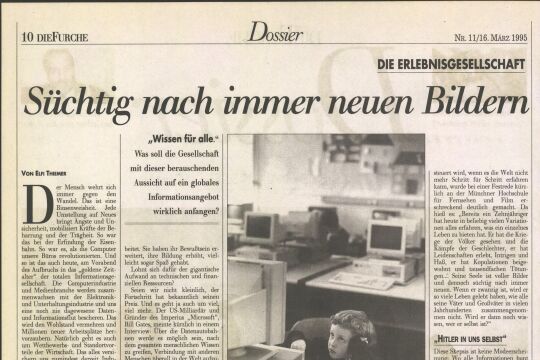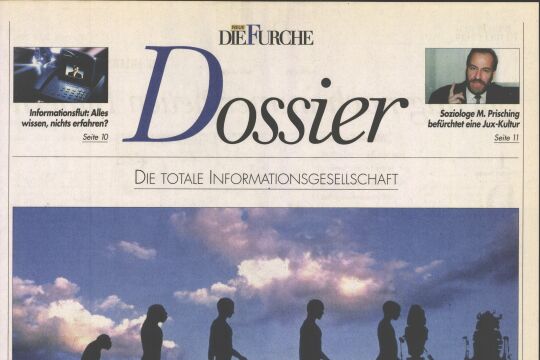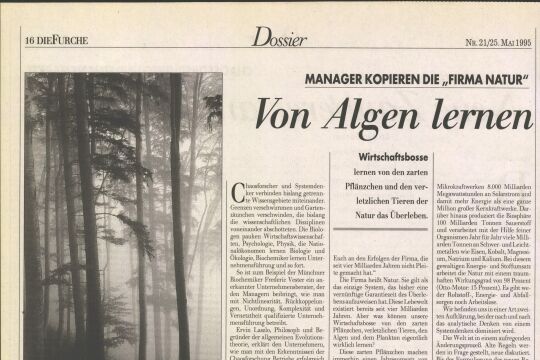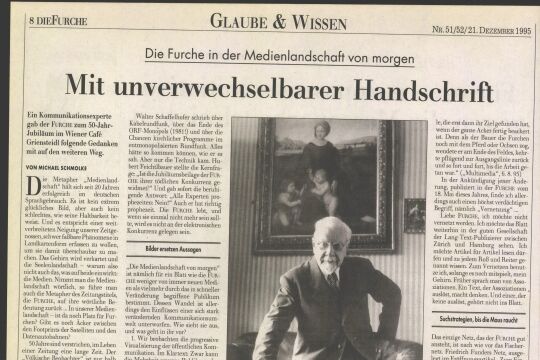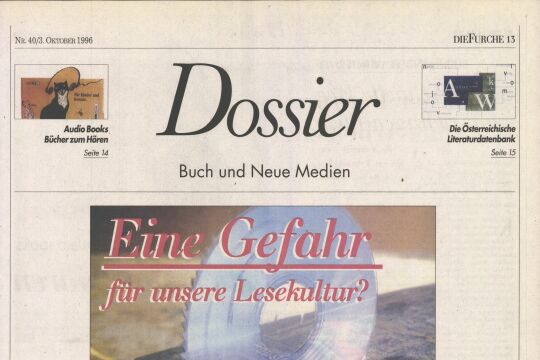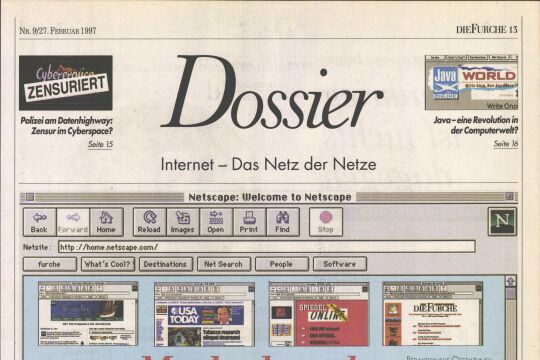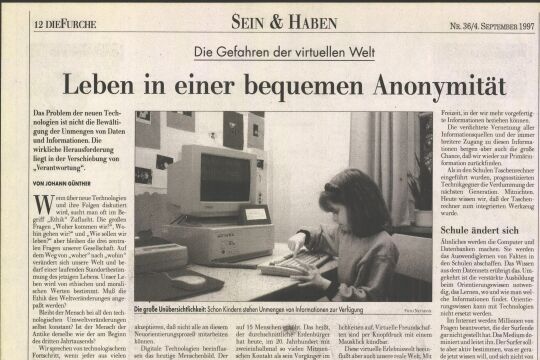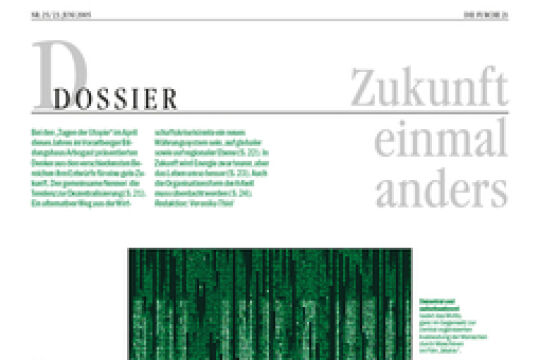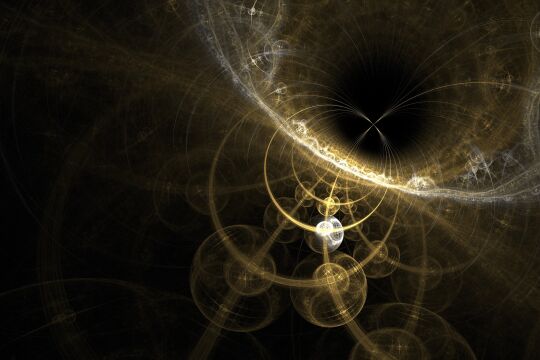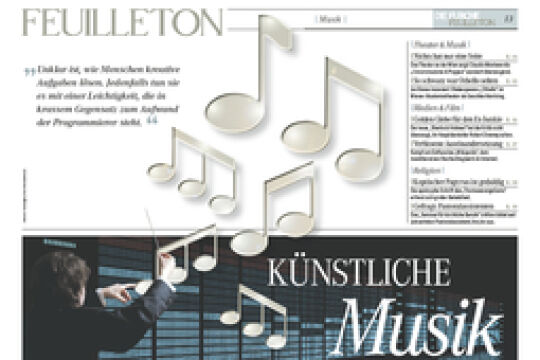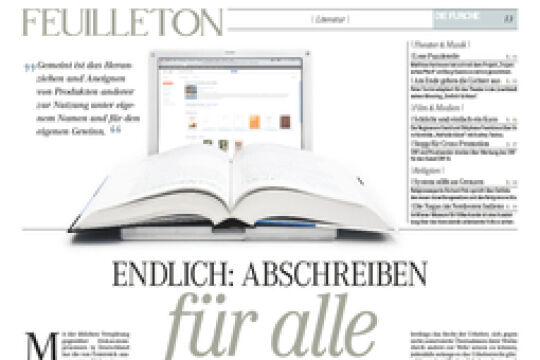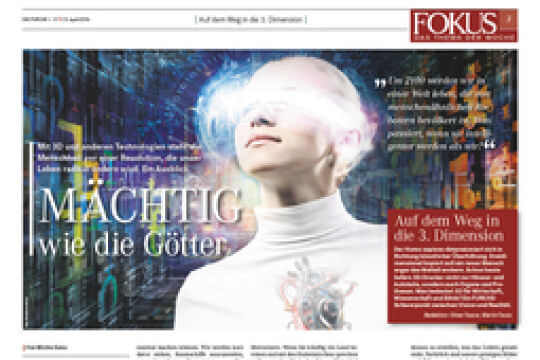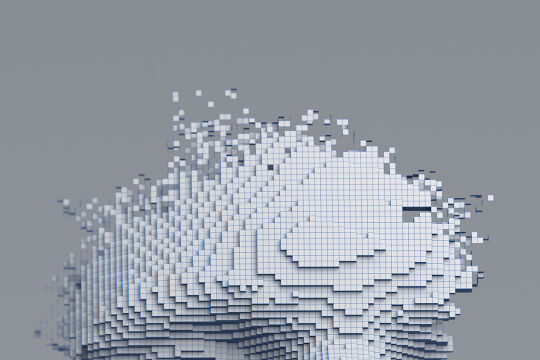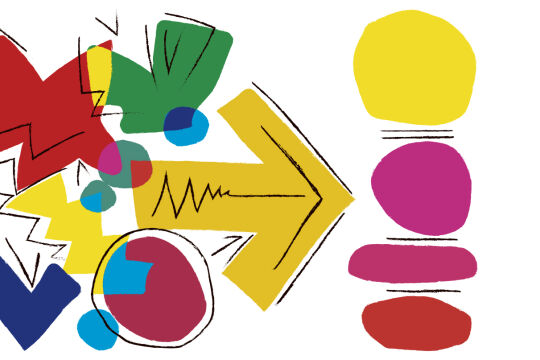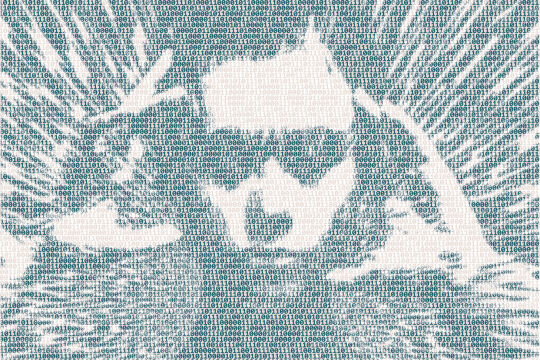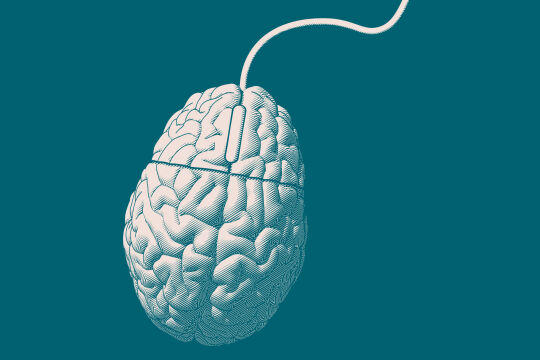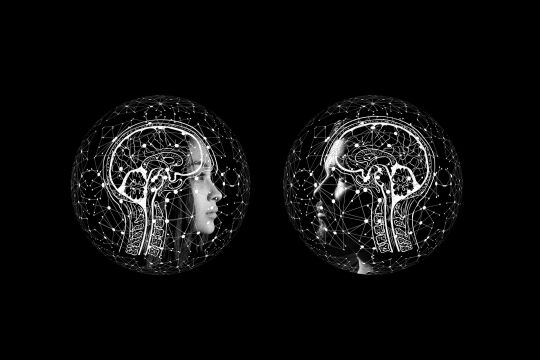Mehr Sprachenvielfalt durch Übersetzungs-Apps?
Nicht nur für Touristen sind Übersetzungs-Apps hilfreich. Künstliche Intelligenz könnte seltene Sprachen vor dem Aussterben retten – und die Bedeutung des Englischen drastisch reduzieren.
Nicht nur für Touristen sind Übersetzungs-Apps hilfreich. Künstliche Intelligenz könnte seltene Sprachen vor dem Aussterben retten – und die Bedeutung des Englischen drastisch reduzieren.
Es gab Zeiten, da liefen Touristen mit zerfledderten Stadtplänen durch Städte und versuchten mithilfe eines Wörterbuchs, Konversationen mit Einheimischen zu führen. Und heute? Da navigiert man mit Google Maps, und wenn man ein Wort nicht versteht, schaut man es schnell im Internet nach. Längst hat man sich daran gewöhnt, Wörter auf der Speisekarte zu googeln oder Sprachassistenten als Dolmetscher im Gespräch zu nutzen. Wörterbücher? Völlig oldschool! Mit dem Smartphone hat mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung einen eigenen Übersetzer in der Hosentasche. Trotzdem gibt es noch immer viele Sprachbarrieren, gerade im Kontakt mit Menschen.
Doch die umtriebigen Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley wollen auch dieses Problem „lösen“. So hat Google vor wenigen Wochen auf seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz I/O den Prototypen einer Augmented-Reality-Brille präsentiert, die mithilfe von Google Translate in Echtzeit gesprochene Sprache transkribiert und den Text auf die Gläser projiziert. So konnte sich eine englischsprachige Frau mit einer Verwandten in Asien, mit der sie zum ersten Mal Kontakt aufgenommen hatte und die nur Mandarin versteht, fast mühelos austauschen. „Untertitel für die Welt“, so nannte Google-Produktmanager Max Spear die sprachgrenzüberschreitende Methode.
Das Suchmaschinenunternehmen hat schon einmal versucht, eine Datenbrille auf den Markt zu bringen – doch die Google Glass ist im Konsumentenbereich gefloppt. Die Träger wurden als „Glassholes“ beschimpft und in San Francisco aus Bars geworfen, weil die Menschen dies als übergriffig empfanden. Nun wagt Google einen neuen Anlauf. Diesmal ohne Kamera und Cyborg-hafte Ästhetik, dafür mit integrierter Live-Übersetzung. Eine solche Anwendung könnte eine Killer-App sein. Denn damit könnte man Konversationen mit Menschen führen, die eine andere Sprache sprechen – und das ohne Simultandolmetscher. Der Traum vom Babelfisch – jenem Gerät aus Douglas Adams Buch „Per Anhalter durch die Galaxis“ (1979), das man sich ins Ohr steckt und das alle Sprache übersetzt – rückt damit in greifbare Nähe.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!