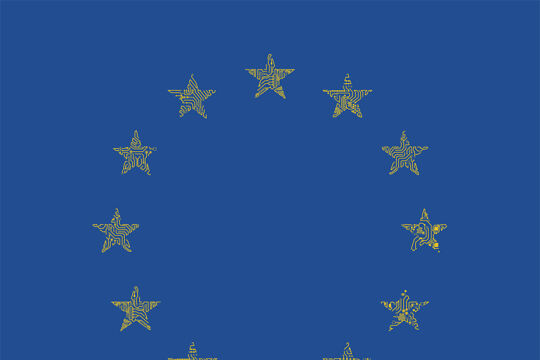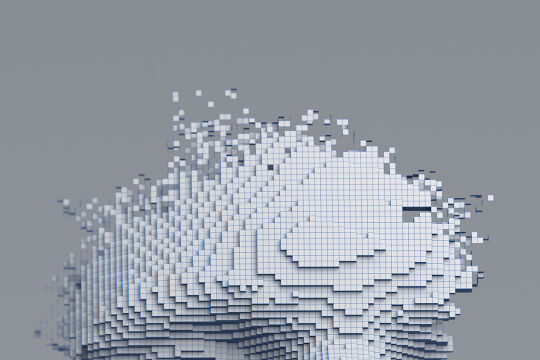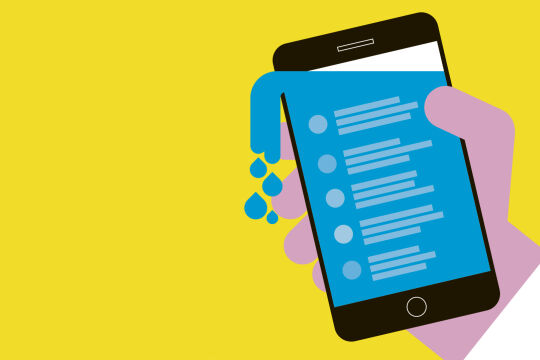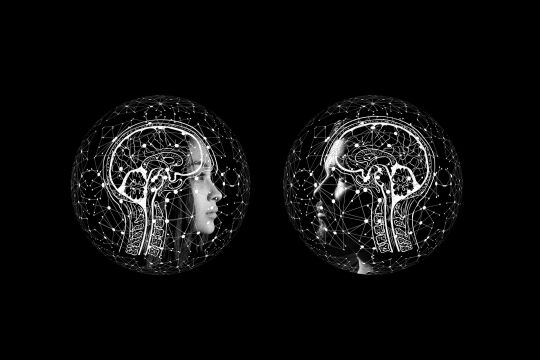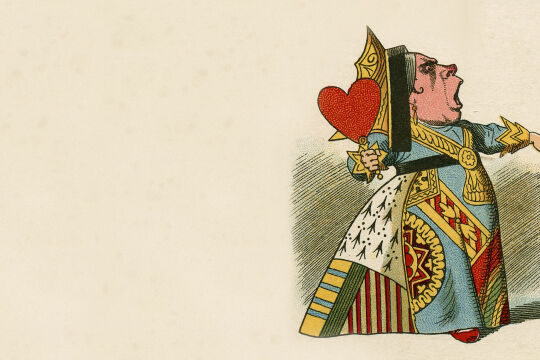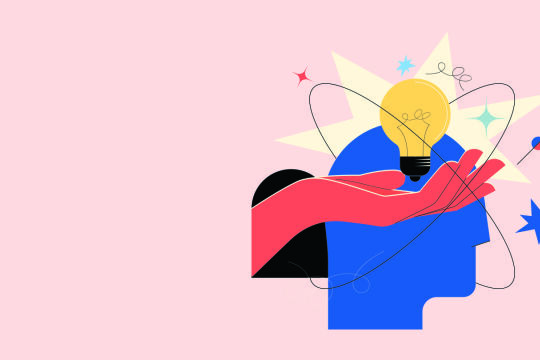Welt der digitalen Möglichkeiten
Warum der digitale und der analoge Raum keine Gegensätze sind und warum es wichtig ist, darüber nachzudenken, wenn wir nicht in einer Postdemokratie landen wollen. Ein Essay.
Warum der digitale und der analoge Raum keine Gegensätze sind und warum es wichtig ist, darüber nachzudenken, wenn wir nicht in einer Postdemokratie landen wollen. Ein Essay.
Kennen Sie den? Kommt ein Mann mit seinem Selfiestick nach Venedig und fällt in den Kanal. Was wie ein Witz klingt, haben wir am vergangenen Wochenende im Internet gesehen: Das Video davon ging viral, wie man so schön sagt, oder eben: Es wurde weit verbreitet und viele haben es gesehen. Sie vielleicht auch? Wie der Mann durchs hüfthohe Hochwasser watet, die Augen auf sein Handy gerichtet? Wie er die Schwelle zwischen Gehsteigkante und Kanal übersieht – die Sie natürlich haben kommen sehen! – und plötzlich plumpst? Wie er die Handyhand in die Höhe reißt und versucht, wieder ans Ufer zu gelangen? Haben Sie gelacht? Ich auch. Vielleicht haben Sie aber auch gedacht: Selber schuld, der Hans-guck-ins-Handy oder, wenn Sie neudeutsch sprechen, dieser Smombie, was eine Wortschöpfung aus Smartphone und Zombie ist.
Junge Menschen ins Smartphone versunken, die sich selbst und ihre Umwelt gefährden, sind ein gern belachtes und oft zitiertes Klischee. Haben uns 20 Jahre Internet blöd gemacht? War damals alles besser, als wir auf der Agfa Clack nur zwischen der Einstellung sonnig und bewölkt wählen konnten und aus dem Urlaub Postkarten schrieben („Wetter gut, Essen schön“), die erst lange nach uns selbst zu Hause ankamen? Wollen wir wieder in einer Welt leben, in der wir ins Kaffeehaus gehen müssen, um mit Glück eine internationale Zeitung zu erwischen? Nun, ich nicht. Und Hand aufs Herz: Sie auch nicht. Und doch scheint unsere Welt im Zuge der Digitalisierung aus den Fugen geraten, wir posten Hass, wir lesen Wut und manche fallen in den Kanal oder laufen gegen einen Laternenpfosten. Wo hört das Digitale auf, wo fängt das Analoge an? Können wir heute analoge und digitale Welten überhaupt noch trennen?
Leben im digitalen Zustand
Die Lehrerin sagt in der Klasse: „Wenn ihr die Schülerin K. das nächste Mal seht, richtet ihr bitte aus, sie möge sich bei mir melden, ich möchte mit ihr sprechen.“ – Keine Minute später klopft es an die Klassenzimmertür, es ist die Schülerin K. Zwei Welten sind aufeinandergeprallt: Die der verständnislosen Lehrerin, die Kommunikation analog begreift. Und die der Schülerin und Schüler, die – ebenso zu Recht – Kommunikation digital begreifen und getan haben, was ihnen aufgetragen wurde: der Kollegin Bescheid gegeben, sie möge sich melden.
Der digitale Zustand ist längst Kulturform geworden: Immer mehr Menschen verhandeln ihn und prägen ihn in immer mehr Lebensbereichen, mit immer komplexeren Technologien, immer aktiv, ob nun freiwillig oder zwangsweise. Wir reagieren und tragen zu seiner noch stärkeren Expansion bei. Und ob es uns nun gefällt oder nicht: Diese Kulturform der Digitalität ist so vielfältig und widersprüchlich wie die Gesellschaft selbst. Der Hass, die Wut, so sind wir auch. Es wird Zeit, eine nicht technikzentrierte Perspektive einzunehmen. Haben Sie Ihre kulturhistorische Brille dabei? Bitte aufsetzen.
Den Begriff des Analogen nützen wir für die Offline-Welt, für die Realität oder auf Neudeutsch für das Real Life. Wir sind damit vertraut. Sprechen wir vom Digitalen, meinen wir die neue Welt, das Internet, Social Media, wir meinen Technologien, manche sagen virtuelle Realitäten und meinen dann Brillen, mit eingebauten Smartphones, die Filme abspielen, die unser Hirn glauben lassen, wir wären ganz woanders. Was die analoge und die digitale Welt verbindet, ist die Kultur, die die Digitalisierung geschaffen hat: die Digitalität.
Die Frage ist längst nicht mehr, ob die Digitalisierung und Digitalität Chance oder Übel sind. Wir müssen entscheiden, ob wir das Netz gestalten wollen. Jetzt.
Andere Schule, andere Lehrerin, andere Schülerinnen und Schüler. Es ist Pause, die Kinder vertiefen sich in die Smartphones. Eh, könnte man denken. Eine Lehrerin will es genauer wissen und spricht die Kinder an. Warum hängt ihr in der Pause am Handy? Warum redet ihr nicht miteinander? Es stellt sich heraus: Sie unterhalten sich ja - auf WhatsApp. Der Kollege C. ist krank, er könnte sonst an der Unterhaltung ja nicht teilnehmen. Die Klassengemeinschaft hat sich ins Digitale verlagert. Mit allen Konsequenzen.
Digitalisierung ist der Prozess, analoge Sachverhalte in einen digitalen zu überführen und ist – ähnlich der Alphabetisierung – eine Kulturtechnik, die Menschen etwas beibringt, was sie vorher nicht machen konnten oder anders gemacht haben. Die Digitalisierung hat die Grundlagen gelegt, um neue Handlungsabläufe, neue Wahrnehmungsformen und Denkstrukturen zu entwickeln.
Digitalität hingegen, so der Schweizer Kultur- und Medienwissenschafter Felix Stalder, der mit seinem Buch „Die Kultur der Digitalität“ (Suhrkamp 2017) einen Klassiker vorgelegt hat, ist das, was entsteht, wenn der Prozess der Digitalisierung eine gewisse Tiefe erreicht hat. Ein neuer Möglichkeitsraum ist entstanden, durch digitale Medien ist er geprägt. Überrollt hat uns das alles nicht, auch wenn es sich heute vielleicht so anfühlt: Digitalisierung und die Kultur der Digitalität sind die Folge eines weitreichenden und unumkehrbaren gesellschaftlichen Wandels, der bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, sich seit den 1960er Jahren jedoch massiv beschleunigt hat. Historisch betrachtet sind die Digitalisierungsprozesse seit dem Jahr 2000 soweit fortgeschritten, dass sie heute die dominante Bedingung sind, unter der wir leben. Seit dem Jahr, in dem wir begonnen haben, das Internet aktiv zu nutzen.
Die immer stärker werdende Präsenz des Digitalen hat bis heute, ungebrochen neben einer Nostalgiewelle nach der guten alten analogen Zeit, auch Ressentiments und Panik ausgelöst. Das trieb und treibt Menschen in die Arme von konservativen, reaktionären Bewegungen, in die Arme von Populisten. Die Idee, dass wir Alternativen zu unserer schnelllebigen Zeit brauchen, ist eine ideologische Behauptung, die Teil ihrer politischen Agenda ist. (Manche von ihnen tragen die Alternative schon im Namen). Wer die Digitalisierung verteufelt und seiner – berechtigten Kritik – an digitalen Dynamiken unkritisch gegenübersteht oder sich gar der Kultur der Digitalität verweigert, wird – auch ungewollt – Teil dieser Maschinerie.
Ein Internet der Demokratie
In der Tat stehen fortgeschrittene Demokratien vor einer tiefgreifenden Entscheidung, ihren Weg in Richtung postdemokratischer Autoritarismus fortzusetzen oder die Demokratie für den digitalen Zustand neu zu erfinden. Um Weichen zu stellen, braucht es Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die anerkennen, dass Wissenshorizonte heute auch mit Shares und Likes entstehen. Es braucht Schulen und Universitäten, die mit dem neuen Entstehen von Wissen umgehen können und ihren Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten lehren, die Wissenshorizonte zu verknüpfen und so algorithmusbedinge Filterblasen zu meiden. Auch auf technologischer Seite braucht es Investitionen. Man kann technische Entwicklung nicht China überlassen und sagen: „Aber bitte denkt dabei an unsere Menschenrechte.“
Die Frage ist längst nicht mehr, ob die Digitalisierung und Digitalität Chance oder Übel sind. Wir müssen entscheiden, ob wir das Netz gestalten wollen oder ob wir das den großen Konzernen überlassen, die, um Profit zu machen, auch zulassen, dass wir aufeinander losstürmen.
Schon heute ist der digitale Raum voll von Aktionen, die Solidarität und Demokratie leben, denen wir aber – vor allem medial – wenig Beachtung schenken. Die ehrenamtliche Organisation #ichbinhier sorgt mit ihren knapp 60.000 Mitgliedern für konstruktiven Dialog in den sozialen Medien, ohne Hass, ohne Hetze. Andere Initiativen vernetzen Einsame an Feiertagen unter #keinerbleibtallein. Auch Einzelnen schlägt immer wieder Trost und Respekt im digitalen Raum entgegen, wie der Kindergartenpädagogin Kathrin Lublig, die sich in diesen Tagen krebsbedingt zum Sterben von Twitter ins Hospiz zurückgezogen hat. Mein Internet besteht aus Menschen jeder Herkunft, aller Religionen, aus solchen,
die sehbehindert sind, solchen, die im Rollstuhl sitzen, verschiedener sexueller Orientierungen und aus Frauen jeden Alters. Und Ihres?
„Was sichtbar ist, schafft Realität“, betont die Soziologin Laura Wiesböck. Im digitalen Raum könnten wir die Sichtbarkeit mitgestalten. Und wenn wir einen Mann im Kanal von Venedig sehen: Ziehen wir ihn doch an seinem Selfiestick heraus.