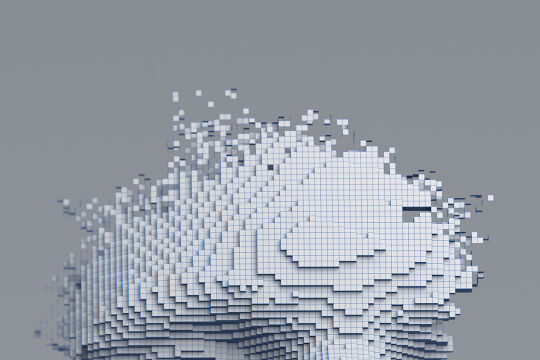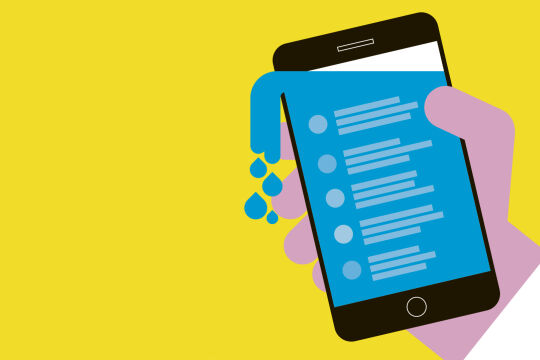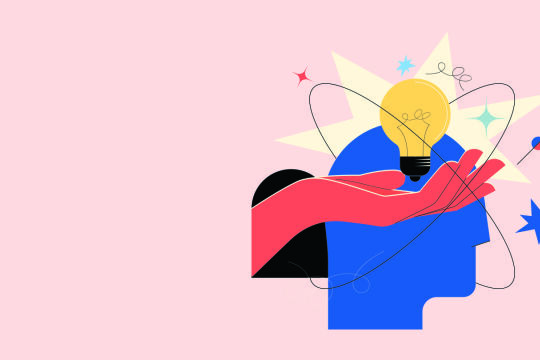Entzauberung des vielarmigen Menschen
Multitasking galt in der neuen Arbeitswelt als Heilsversprechen der Effizienzsteigerung. Doch jüngere Forschungen zeigen das Gegenteil: Immer wieder gleichzeitig mehrere Aufgaben bewältigen zu wollen, schwächt die Leistung und gefährdet die Fähigkeit zur Empathie.
Multitasking galt in der neuen Arbeitswelt als Heilsversprechen der Effizienzsteigerung. Doch jüngere Forschungen zeigen das Gegenteil: Immer wieder gleichzeitig mehrere Aufgaben bewältigen zu wollen, schwächt die Leistung und gefährdet die Fähigkeit zur Empathie.
Eine Vorlesung über "Medienwandel" im Wiener Audimax: Spätestens nach 15 Minuten bricht die Kurve der Aufmerksamkeit bei den Studierenden ein. Wer bis dahin noch nicht die E-Mails auf seinem Laptop oder Tablet gecheckt hat, holt nun sein Smartphone heraus und überprüft unruhig, ob eine neue Nachricht eingegangen ist. Keine Karikatur studentischer Unkonzentriertheit, sondern vielfach vertrauter Alltag in westlichen Universitäten.
Gemäß Daten der ARD/ZDF-Onlinestudie (2014) sind junge Menschen im Durchschnitt 248 Minuten täglich online. Tendenz: zunehmend. Sie kommunizieren aber nicht nur jederzeit und überall, sondern neigen auch dazu, mehr als eine Informationsquelle gleichzeitig zu benutzen. Die Mediennutzung wird immer mehr vom Smartphone dominiert, das sich mit so dynamischen Wachstumsraten verbreitet wie kein anderes Medium zuvor. Mit dem Smartphone verbinden sich zwischenmenschliche und Massenkommunikation, betont der Medienforscher Peter Vorderer von der Universität Mannheim: "Wenn ich Studierende in der Mensa beobachte, dann sitzen dort Gruppen, die in der rechten Hand die Gabel haben und in der linken das Smartphone, die miteinander kommunizieren und gleichzeitig immer wieder auf ihr Smartphone schauen. Entweder um Massenkommunikation abzurufen oder um mit Personen, die in diesem Moment nicht anwesend sind, zu kommunizieren. Also eine Art Hybridsituation."
Permanente Nutzungsbereitschaft
Zum veränderten Mediengebrauch gehört die "Vigilanz", eine permanente Nutzungsbereitschaft: "Checking behaviour" ist der Fachbegriff dafür. Auch wenn das Smartphone nur ruhig auf dem Tisch liegt, beschäftigt es das Denken. Aufmerksamkeitsfokussierung auf etwas, das noch nicht eingetroffen ist, nennt das der Medienforscher. Erste Studien, die dazu vorliegen, verweisen auf mögliche Folgen: "Auseinandersetzungstiefe Formen der zwischenmenschlichen Kommunikation und Empathie, also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, leiden allein durch die Anwesenheit eines Smartphones", so Peter Vorderer.
Viele Arbeitgeber klagen bereits, dass ihre Angestellten abgelenkt sind durch Smartphone und Computer. Andererseits finden Psychologen es problematisch, dass durch mobiles Arbeiten und permanente Erreichbarkeit über das Smartphone die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zunehmend verschwimmt. Multitasking erscheint dennoch oft als Heilsversprechen, um den wachsenden Druck zu bewältigen. Die Möglichkeit, das Gehirn auf diesem Gebiet zu optimieren, wird aber überschätzt. Bildgebende Verfahren haben gezeigt, dass das menschliche Gehirn nur zwei Aufgaben parallel relativ gut bewältigen kann. Dabei werden die Gehirnleistungen auf die rechte und linke Großhirnhemisphäre verteilt.
"Der Platz in unserem 'Arbeitsspeicher' ist begrenzt", betont der Neurobiologe Martin Korte von der TU Braunschweig. Beim Multitasking werden mehrere Dinge gleichzeitig bearbeitet, dauernd erfolgt dabei der Wechsel zwischen den Themen. Die selektive Steuerung der Aufmerksamkeit ist abhängig vom Arbeitsgedächtnis. Dessen Leistung wird aber tendenziell nicht besser, sondern eher schlechter, je öfter man mehrere Dinge gleichzeitig macht. Überlastung durch Multitasking kostet offenbar kognitive Ressourcen und "Tiefe" an Aufmerksamkeit. Man wird nicht effektiver, sondern schwächt damit seine Aufmerksamkeit.
Schon die bloßen Gedanken an Nachrichten, E-Mails und Chats okkupieren Teile des Arbeitsspeichers. Die "Informationsabwehr" kostet Aufmerksamkeit. Nach jeder Unterbrechung benötigt das Gehirn ungefähr 15 Minuten, um sich wieder auf den Stoff zu konzentrieren. Schuld daran sind aber nicht die neuen Medien an sich, sondern ein falscher Umgang damit.
Aufmerksamkeit ist gleichsam ein Portal zwischen der Informationsflut und dem Gehirn. "Wenn Menschen schon in jungen Jahren viel Zeit vor Apparaten verbringen und Multitasking betreiben, verlieren sie möglicherweise auch einen Teil der Fähigkeit zu ergründen, was andere denken und fühlen", fürchtet der Neurobiologe Martin Korte. Mit Multitasking drohe eine "Verwahrlosung des Stirnlappens", vor allem bei der Generation der "Digital Natives"(jenen, die bereits in der Welt der neuen Medien aufgewachsen sind). Und damit würde auch ein Schwinden der Fähigkeiten zur Empathie einhergehen, die nicht in Chatrooms gelernt werden kann. Denn dazu bedarf es der Begegnung mit einer "dreidimensionalen" Person und der Kommunikation mit allen Sinnen.
Internet-basierte Lernformen
Das menschliche Gehirn ist überaus formbar und lernfähig. Jede Generation konfrontiert es mit neuen Techniken und Anpassungsprozessen. Wenn Menschen lernen, sich im Internet zu bewegen, Computer und Smartphones zu benutzen, verändert sich auch das Gehirn strukturell und funktional. Ältere Mediengenerationen haben mit großer Selbstverständlichkeit gelernt, Wissen im Kopf abzuspeichern, auf das sie zuerst zurückgreifen. Die digitale Mediengeneration, so Martin Korte, aktiviert auch bei einfachen Fragen zuerst analytische Gehirnareale auf der Suche nach einer Strategie, um im Internet die passende Antwort zu finden. Das hilft bei der Orientierung und Navigation in virtuellen Informationswelten. Problematisch wird es aber, wenn jemand ganz auf externes Wissen in Suchmaschinen angewiesen ist und die Fähigkeit verloren geht, Informationen kritisch im Kontext des eigenen Wissens zu bewerten. Die Teilhabe an politischer Bildung und Demokratie setzt aber gerade diese Fähigkeit voraus.
Es wird zur Herausforderung für das Bildungssystem, einen Bildungskanon als gemeinsame Wissensplattform zu erhalten, Schülern und Studierenden aber auch den kreativen Umgang und das Lernen mit digitalen Medien auf Augenhöhe zu vermitteln. Die Aufgaben sollten dabei besser strukturiert und Schritt für Schritt erledigt werden. Mails und soziale Netzwerke sind in der Konzentrationsphase Tabu. Das bedeutet aber keine generelle Abschottung von neuen Medien. Internet-basierte Lernformen bieten auch viele Vorteile und ermöglichen selbstgesteuertes Lernen. Darauf müssen sich auch viele Lehrer erst noch einstellen.
Multitasking, ständige Erreichbarkeit und permanente Präsenz in Mediennetzwerken werden von manchen Menschen bereits als Belastung empfunden. Temporäre Ausstiegsszenarien werden diskutiert. Trotzdem ist der Trend noch ungebrochen, immer mehr Zeit für mediale Interaktion zu verwenden. Eine Langzeitstudie des "World Internet Project" in mehr als 20 Ländern hat ergeben, dass für die meisten Nutzer die akzeptable Zeitspanne zwischen dem Verschicken einer Nachricht und der Antwort darauf kontinuierlich schrumpft. Vor allem junge Mediennutzer setzen alles daran, aus ihrer sozialen Medienwelt nicht mehr aussteigen zu müssen. Dabei wirkt vielleicht eine Erfahrung unserer Vorfahren nach, meint der Medienforscher Peter Vorderer: Ein Ausschluss aus der Gruppe wurde wie ein Todesurteil empfunden, da ein Überleben von der Kooperation im sozialen Verbund abhing. In der "digitalen Community" muss der eigene Stellenwert durch ständige Präsenz und Interaktion gesichert werden.
Um die Potenziale neuer Medien gerade auch für das Lernen ausschöpfen zu können, wird die Erhaltung der Aufmerksamkeit ein Schlüsselfaktor. Da derzeit jüngere Menschen von der Versuchung, permanent online zu sein, eher betroffen sind als ältere, ist das möglicherweise erst der Beginn einer Entwicklung. Diese könnte nicht nur die Mediennutzung, sondern die gesamte "digitale Kultur" verändern. Eine Chance besteht darin, neue Medienkompetenzen auszubilden, sich interaktiv im multimedialen Zeitalter zu behaupten, aber auch "Auszeiten" bewusst zu gestalten.
Die Gefahr, sich in Zerstreuung, Oberflächlichkeit und einem "digitalen Burnout" zu verlieren, ist aber nicht zu übersehen. Umso wichtiger wird es, die Grenzen der Multitasking-Fertigkeiten des Gehirns realistisch zu betrachten, eine Vertiefung in neue Formen des Lernens zu fördern und den Wert echter Aufmerksamkeit in menschlichen Begegnungen zu vermitteln.
Der Autor ist Leiter der Hauptabteilung "Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft" im ORF-Hörfunk