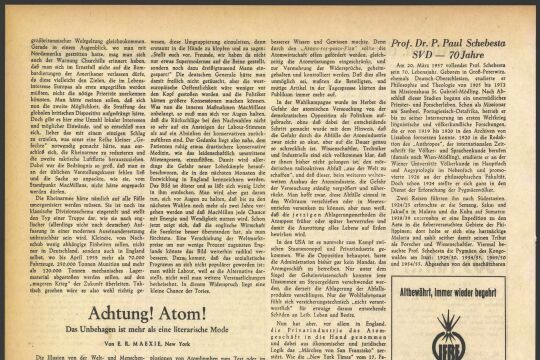Die Welt ist klein geworden. Doch nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen sind heute Kosmopoliten - manchmal mit gravierenden Folgen für das lokale Ökosystem.
Dank Autobahnen überwinden Menschen heute große Distanzen im Nu - und Pflanzensamen und-pollen reisen mit. Mit dem geladenen Ballastwasser führen Schiffe viele aquatische Lebewesen um die Welt. Tiere entkommen aus Zoos und exotische Gartenpflanzen schaffen es in die freie Natur. "Plus ein zusätzliches Lebewesen heißt nicht unbedingt, dass damit die Biodiversität um eins gestiegen ist", meinte Wolfgang Rabitsch, Mitorganisator des vierten Europäischen Neobiota-Kongresses in Wien. Dass Neobiota eine Plage sein können, betonte auch der US-Experte Daniel Simberloff in seiner Key Lecture. "Die von invasiven Arten verursachten ökonomischen Schäden belaufen sich allein in den USA auf rund 137 Milliarden Dollar pro Jahr und mehr als eine Billion Dollar weltweit. Damit sind die Auswirkungen gravierender als jene des Klimawandels." Trotz dieses Faktums bemühte sich Simberloff um Optimismus: Wir können etwas tun. Sein Actionplan war einfach und klar. Erstens sie draußen halten. Zweitens sie ausrotten. Drittens sie vernünftig managen.
Weg mit euch
Dass für die erste Strategie wenig Spielraum besteht, gab er postwendend zu. Grund dafür sei der freie Welthandel. Eine Nation könne sich zwar an die WTO wenden, wenn sie eine bestimmte Art nicht im eigenen Land haben wolle. Allerdings müsse sie nachweisen, dass die Art tatsächlich invasiv wäre und Lebensräume zerstöre. "Dabei fordern die jetzigen Gesetze eine quantitative Risikoanalyse, die oft technisch nicht möglich ist," meinte Simberloff.
Also Strategie zwei: Ausrotten (Strategie drei - das Monitoring invasiver Arten - schien für Simberloff eher ein letzter Notgriff zu bleiben). "Ausrotten hat einen schlechten Namen, aber es gibt viele Erfolgsgeschichten", versicherte der US-Biologe und nannte etwa die Ausrottung von Nagetieren in Neuseeland, von Malaria übertragenden Anopheles-Mücken in Brasilien und von Igelstachelgras in den USA. Den Erfolgsgeschichten stellte er vergleichend Misserfolge gegenüber, um so Kriterien für den Erfolg herauszuarbeiten. Dabei entschuldigte er sich im Voraus bei dem vorwiegend europäischen Publikum: "Viele der traurigen Misserfolge stammen leider aus Europa."
Zum Beispiel die als Killeralge bekannt gewordene Caulerpa Taxifolia. Die Aquariumpflanze tauchte erstmals 1984 vor der Küste Monacos auf. Die Europäer machten zwei Fehler in der Bekämpfung: Erstens zauderten sie zu lange. Zweitens versuchten sie es mit einer hoch spezialisierten Meeresschnecke, die die winterlichen Temperaturen des Mittelmeerwassers nicht überlebte. Das Ergebnis:
Heute sind rund 13.000
Hektar des Mittelmeers mit der Alge zugedeckt. Die Chancen einer Ausrottung stehen bei Null. Die Amerikaner waren also gewarnt, als sie im Jahre 2000 an zwei Stellen der kalifornischen Küste - Agua Hedionda Lagoon und Huntington Harbour - die berüchtigte Pflanze entdeckten. Sie handelten rasch, indem sie die Algenteppiche mit Planen überdeckten und haufenweise giftiges Chlorgas ins Wasser pumpten. Das Resultat: Alles Leben starb ab. Nur: die lokale Meereswelt hat sich mittlerweile wieder erholt. Die Killeralge aber wurde seither nicht mehr gesehen.
Simberloff machte keinen Hehl daraus, dass er die Chemiekeule für ein probates Mittel hält. Darauf im Interview angesprochen, meinte er: "Umweltschützer haben eine Gleichung im Kopf: Chemie = schlecht. Deshalb habe ich auch ausdrücklich auf Rachel Carsons Buch Silent Spring verwiesen. Dieses Buch hat die Haltung einer ganzen Generation von Biologen maßgeblich geprägt. Und natürlich hatte Carson damals Recht (dass der Einsatz von Chemikalien nicht nur Schädlinge tötet). Aber ich glaube auch, dass Chemikalien seither stark weiterentwickelt wurden."
Ein andere große Herausforderung bilden nach Simberloff "charismatische Wirbeltiere" wie das Grauhörnchen. In England und Irland etwa war das Grauhörnchen Ende des 19. Jahrhunderts aufgetaucht und verdrängte dort sukzessive seine roten Verwandten, so dass es dort heute keine roten Eichhörnchen mehr gibt. Als sich das Grauhörnchen Ende der 1980er Jahre plötzlich in Norditalien auszubreiten begann, erkannte Piero Genovesi vom Italienischen Institut für Naturschutz schnell die Gefahr und warnte vor den Folgen. "Im letzten Moment gelang es uns, die volle Unterstützung der Politiker, ja sogar des WWF, zu bekommen", erzählt Genovesi. Anders als in anderen Ländern wollten die italienischen Naturschützer die Grauhörnchen weder erschießen noch vergiften, sondern sie mit einer Überdosis Schlafmittel sanft ins Jenseits befördern.
Radikale Tierquälerei?
Doch dann wurde Genovesi von einer Gruppe radikaler Tierschützer wegen Tierquälerei angeklagt. Das ganze Unternehmen kam zu einem Halt. Als Genovesi zwei Jahre später freigesprochen wurde, war die Epidemie nicht mehr aufzuhalten. Einzig bei einer Waldschneise, die von Milan aus ins Tessin führt, wollen die Italiener heute dem Tier an den Pelz gehen. "Wir hoffen, so eine Einwanderung nach Europa um hundert Jahre verzögern zu können. Schafft es das Grauhörnchen in die Schweiz, dann ist es bald in Österreich und dem Rest von Europa. Das aber wäre das Ende des roten Eichhörnchens."
Nach Simberloff zeigt dieser Fall, dass man auch die breite Öffentlichkeit auf seiner Seite haben muss, will man im Kampf gegen Bioinvasoren erfolgreich sein. Genovesi sieht das ähnlich: "Medienarbeit ist wichtig. Die ersten Reaktionen gegen meine Person waren sehr stark. Warum wollen Sie ein so herziges Tierchen umbringen, wurde ich wiederholt gefragt. Doch wenn ich Gelegenheit bekam, das zu erklären, zeigten sie auf einmal Verständnis."