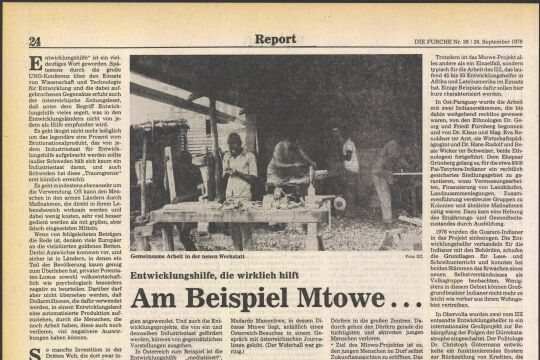Marokko steht seit Wochen im Mittelpunkt eines Flüchtlingsdramas: Tausende Menschen, zumeist aus Ländern südlich der Sahara, versuchen nach Melilla und Ceuta zu gelangen, der zweiten spanischen Enklave am Mittelmeer. Mindestens ein Dutzend Menschen kamen dabei ums Leben. Einige blieben in den Stacheldrahtzäunen hängen, andere wurden von Sicherheitskräften auf der Flucht erschossen. Weitere 400 Afrikaner drohen nun in der marokkanischen Wüste zu verdursten oder zu verhungern.
Mohamed Moussa Camara gehörte zu den Verzweifelten, und er hat es geschafft. Gemeinsam mit Hunderten anderen Flüchtlingen stürmte der junge Mann aus Mali letzte Woche den Grenzzaun, der Melilla von Marokko trennt. "Ich habe furchtbar gelitten, doch nun habe ich endlich diese geweihte spanische Erde erreicht", sagte der 21-Jährige einem Korrespondenten von Agence France Press. Seine Flucht aus Mali dauerte mehrere Jahre: "Ich habe geweint, als ich meine Eltern zurücklassen musste. Doch ich konnte dieses Elend, die Arbeitslosigkeit und die Krankheiten nicht mehr ertragen", sagt er. "Ich wollte nach Europa, koste es, was es wolle."
Nicht allein in Frieden leben
Gefördert von der Weltbank kam es Ende der 1960er Jahre zu einer Wiederbelebung des Marshall-Plan-Gedankens: Bis 1975, so der damalige Kerngedanke, sollten die Industriestaaten es schaffen, 0,7 Prozent ihres bip an Entwicklungshilfe zu leisten - die Begründung für diese Zielvorgabe war teils moralischer Natur, teils aufgeklärtes Eigeninteresse.
Und damit ist die Geschichte der Entwicklungshilfe in der Gegenwart angekommen: Einerseits, weil die entwickelte Welt nach wie vor bis auf sehr wenige Ausnahmen dem 0,7-Versprechen nicht nachkommt; andererseits, weil in Zeiten von grenzüberschreitendem Terror, grenzüberschreitenden Epidemien und grenzüberschreitenden Flüchtlingsströmen das "Cui bono?", das "Wem nützt es?" der Entwicklungshilfe so eindeutig wie nie zuvor vom Kopf auf die Füße gestellt wird: Entwicklungshilfe ist nicht Wohltätigkeit, kein Almosen, kein einseitiger Akt derer, denen es gut geht, sondern Entwicklungszusammenarbeit ist die unerlässliche Investition für gemeinsame Sicherheit und Wohlstand. Und das scheint mittlerweile sogar us-Präsident George w. Bush klar geworden zu sein, heißt es doch in der amerikanischen Sicherheitsstrategie: "Eine Welt, in der einige bequem und im Überfluss leben, während die Hälfte der Menschheit von weniger als zwei Dollar am Tag lebt, ist weder gerecht noch stabil."
EZA nach dem Kalten Krieg
Diese Motivation für Verzerrungen in der Entwicklungshilfe gibt es heute nicht mehr, und die Geber-Länder hätten die Gelegenheit, ihre Entwicklungshilfe allein auf die Verbesserung der Lage der Menschheit zu richten. Wenn nicht wirtschaftliche Eigeninteressen oder der "Krieg gegen den Terrorismus" erneut die Entwicklungshilfe zu bestimmen anfangen und Ländern mit zweifelhafter Entwicklungsbilanz einen warmen Regen an vielfältiger Unterstützung bescheren.
Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit kommt aber auch aus den Entwicklungsländern selber: Das Schlimmste an fremder Hilfe sei, heißt es im Monitor in Uganda, dass sie demokratischen Fortschritt und Reformen verhindere: "Entwicklungshilfe ist Gift für den Armen, so wie Schokolade für den Zuckerkranken."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!