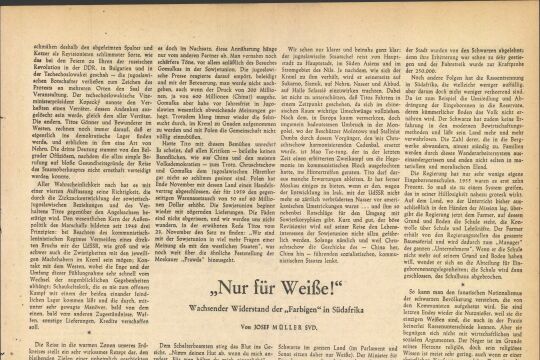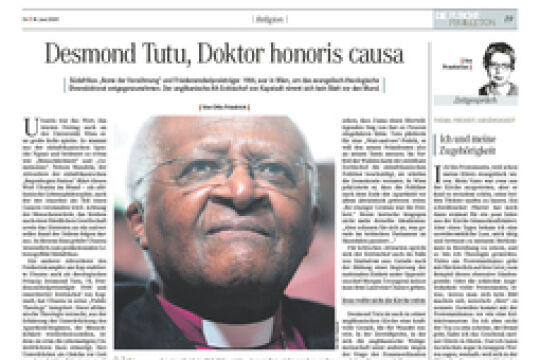Nachruf auf Nelson Mandela, der südafrikanischen Ikone des Freiheitskampfes und der Versöhnung zugleich, der im 95. Lebensjahr verstorben ist.
Die größte Lebensleistung von Nelson Mandela liegt eines Nachts in einem Haus am Stadtrand von Johannesburg vor mir auf dem Küchentisch. Es ist Jänner 1988. Mandela sitzt seit 25 Jahren im Gefängnis. Die Regierung Reagan wird ihn in diesem Jahr als "Terroristen“ auf die US-Watch List setzen, das Europaparlament anlässlich von Mandelas anstehendem 70. Geburtstag seine Freilassung fordern und Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß besucht zeitgleich mit mir und meinem Freund Südafrika und verlangt nach seiner Rückkehr "nachdrücklich die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen gegen die Republik Südafrika“. Diese seien "falsch und unwirksam“ und träfen "nur die schwarze Bevölkerung, der man eigentlich helfen will“.
Doch zurück an den Küchentisch: Revolver und Pistolen, mindestens vier oder fünf, liegen dort und daneben stapeln sich Munitionsschachteln und Much bringt noch weitere Plastiktaschen voller Patronen, stellt diese ab und holt noch mehr davon aus allen möglichen Verstecken in seinem Haus.
Much ist ein Tiroler Maurer, der es im Apartheid-Südafrika der 1970er- und 1980er-Jahren zu einer Baufirma und Wohlstand gebracht hat. Der von seinen Gästen aus der Heimat mitgebrachte 80-prozentige Stroh-Rum hat ihm die Zunge gelöst und das Herz geöffnet, nachdem es wohl schon seit langem zur Mördergrube geworden war. Und um uns "dummen Buaben“ zu zeigen, dass er kein Tiroler Dampfplauderer ist, hat er sein Waffenarsenal auf dem Küchentisch ausgebreitet, damit wir glauben, was er sagt: "Wenn sie kommen, dann bin ich bereit, dann werden sie was erleben, dann nehme ich soviele wie möglich mit ins Grab …“
Seine Lebensleistung
Sie, das sind die Schwarzen Südafrikas. Die Schwarzen, die ihm am nächsten Morgen auf diesem Küchentisch schon wieder das Frühstück herrichten werden, die seinen Rasen mähen und den Swimming-Pool reinigen, die schwarzen Südafrikaner, die in seiner Firma, in seinem Namen, für sein Einkommen Häuser bauen, die Schwarze, die er in sein Bett holt, wenn kein Rum im Haus ist oder der auch nicht mehr hilft.
Sie sind aber nicht so gekommen, wie Much im Jänner 1988 felsenfest überzeugt war, dass sie kommen werden: Über die mit einbetonierten Glasscherben bewehrten Gartenmauern, über den englischen Rasen, am Pool vorbei, rachelüstern, verheerend, schießend, mordend, brandschatzend. Sie sind weiterhin nur so gekommen, wie sie schon immer zu ihm gekommen sind, um zu arbeiten, um zu bedienen.
Das ist die Lebensleistung von Nelson Mandela. Dass das Waffen- und Munitionslager auf diesem und vielen anderen südafrikanischen Küchentischen nicht seine Todesgewalt entladen konnte. Dass Mandela nach seiner Freilassung dem Rad der drohenden Unheils-Geschichte in die Speichen gegriffen hat und den verfahrenen südafrikanischen Staatskarren nicht in eine Gewaltsspirale schlittern ließ.
Den britischen Namen Nelson hat Mandela erst bei seiner Einschulung bekommen; geboren wird er am 18. Juli 1918 als Rolihlahla Dalibhunga Mandela. Diesem ursprünglichen Namen "Rolihlahla“ hat er alle Ehre gemacht, der bedeutet nämlich wörtlich übersetzt "am Ast eines Baumes ziehen“, was man gern mit "Unruhestifter“ gleichsetzt. Das wird mittlerweile gerne ausgeblendet oder ist einfach in Vergessenheit geraten: Bevor Mandela der Versöhner und Advokat des Verzeihens wurde, war er der Aufwiegler und zornige wie gewaltbereite Anwalt der Geknechteten.
1988, als uns Much sein Schreckenszenario für die südafrikanische Zukunft präsentierte, war dieses Bild von Mandela noch vorherrschend - in Südafrika und international. Die Sowjetunion bringt in diesem Jahr eine 10-Kopeken-Briefmarke heraus, mit dem Titel "Nelson Mandela - Kämpfer für die Freiheit Südafrikas“ und einem grimmigen Porträt Mandelas, bei dem nicht nur Kinder sofort an das berüchtigte "Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann …“ denken - und davonlaufen wollen.
1988 war in Südafrika aber auch schon deutlich zu spüren, dass das Apartheid-Regime am absteigenden Ast war, dass die "Rolihlahlas“ am längeren Ast sitzen werden. Auf den Zugwaggons oder auf Parkbänken stand zwar noch immer "Net blankes“ und "Whites only“ zu lesen. Diese Trennwände im öffentlichen Raum wurden von uns Touristen auch gerne fotografiert, getrieben von dem verschämten "tremendum-fascinosum“-Gefühl, mit dem Unbeteiligte, Zuspätkommende oder Nachgeborene sich aus sicherer Entfernung dem Grauen zu nähern trauen. Im täglichen Miteinander aber war die Apartheid gerade dabei zu verdampfen, hatte der südafrikanische Bürgerrechtler Steve Biko mit seiner Maxime, der er sein Leben geopfert hat, recht behalten: "Es ist besser für eine Idee zu sterben, als für eine Idee zu leben, die sterben wird.“
Entlassung abgelehnt
1988 hätte die südafrikanische Regierung den prominentesten Häftling der Welt auch gewiss lieber heute als morgen losgehabt. Aber wie? Umbringen hatte schon bei Biko nicht funktioniert, und das waren noch andere Zeiten gewesen. Entlassen? Ja, unter der Bedingung, dass der Führer des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) der Gewalt abschwört. Doch Mandela lehnte ab. Noch oder besser gesagt: immer noch. Denn am Anfang seiner politischen Arbeit war Mandela ein überzeugter Verfechter des gewaltlosen Widerstands gewesen. Das änderte sich im März 1960, nachdem beim sogenannten Massaker von Sharpeville unbewaffnete schwarze Demonstranten von der Polizei erschossen wurden. Von da an erst akzeptierte er den gewaltsamen Kampf. Der Grund für den Hass, aus dem sich diese Gewaltbereitschaft speiste, findet sich in einem Zitat Mandelas zur Ermordung Bikos: "Sein Leben wurde mit mehr Lässigkeit und Gefühllosigkeit ausgelöscht, als eine Kerzenflamme zwischen einem schwieligen Daumen und dem Zeigefinger.“
Diese Verachtung gegen ein Leben, nur weil es eine andere Hautfarbe hat, das konnte, das wollte, das durfte Mandela nicht ungesühnt lassen. Mit der Kapitulation des Apartheid-Regimes und seiner bedingungslosen Freilassung am 11. Februar 1990 war jedoch der Rache genüge getan. Noch am selben Tag spricht sich Mandela in einer Rede vor 120.000 Menschen für Versöhnung aus. Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan erklärt das so: "Er ist in meiner Kultur aufgewachsen. Wir glauben, dass man bei bestimmten Gelegenheiten Kampf und Streit vergisst.“
Simon Inou, der österreichische Journalist und Medien-Manager aus Kamerun, hat zu einem Jahrestag dieser Freilassung in der FURCHE geschrieben: "An diesem 11. Februar gärte und kochte es auf dem afrikanischen Kontinent. Endlich war Mandela wieder unter ihnen. Jetzt war die afrikanische Familie vollständig und bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Durch die Person Mandela war es noch immer und wieder erlaubt zu träumen.“