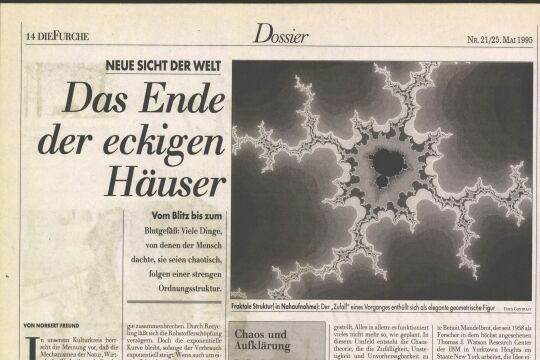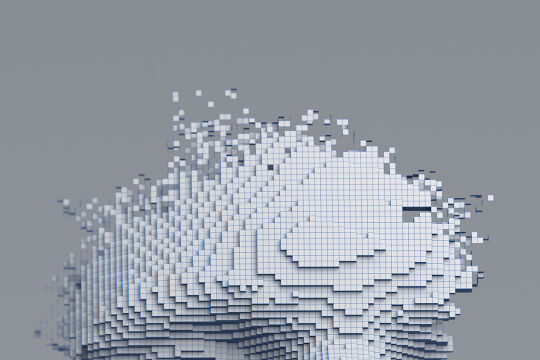Die Netzwerktheorie schickt sich an, die Welt des Komplexen zu erklären. Wie etwa soziale Beziehungen und biochemische Prozesse.
Ein Mathematiker ist eine Maschine, die Kaffee in Theoreme umwandelt", pflegte Paul Erdös zu sagen, Alfréd Rényi zitierend. Erdös trank Kaffee in großen Mengen und brachte es so auf mehr als 1500 Publikationen in seinem Mathematikerleben. Seit Leonhard Euler hatte kein Mathematiker so viel gedacht und geschrieben, so dass Erdös heute als einer der ganz Großen seines Faches gilt. Zusammen mit seinem ungarischen Landsmann Rényi publizierte er acht Artikel, die sich erstmals der fundamentalen Frage widmeten, wie sich unser verwobenes Universum verstehen lässt. Offensichtlich ist alles mit allem irgendwie verbunden: Menschen mit anderen Menschen. Neuronen mit anderen Neuronen. Webseiten mit anderen Webseiten. Moleküle mit anderen Molekülen. Doch wie bilden sich Netzwerke?
Ein Gedankenexperiment
Organisieren wir eine (imaginäre) Party mit hundert Gästen. Keiner soll einen anderen kennen. Versorgen wir die Leute mit Party-Häppchen und Wein, so werden sie sich gesellig zeigen: Sie werden miteinander zu reden beginnen. Dabei werden sich jeweils zwei bis drei Leuten zusammenfinden. Insgesamt werden sich also dreißig bis vierzig kleine Gruppen bilden. Nach einer gewissen Zeit werden sich die Leute langweilen und sich einer anderen Gruppe anschließen, um so neue Gesprächspartner zu haben. Nehmen wir weiters an, wir erzählen einem Gast von einem besonders teuren und weitaus besseren Wein, den es zu trinken gibt. Er darf (und wird) den Wein auch weiterempfehlen, jedoch nur an jene Leute, die er gerade kennen gelernt hat. Die anderen Leute werden dasselbe tun. Wie lange wird also das Geheimnis vom guten Wein gewahrt bleiben? Nach Erdös und Rényi würde sich binnen dreißig Minuten ein unsichtbares soziales Netzwerk geformt haben, das alle Gäste im Raum umfasst. Dementsprechend schnell könnten wir die guten Weinflaschen leer sehen.
Das Party-Beispiel ist instruktiv dafür, wie sich Erdös und Rényi Netzwerke dachten. Die sozialen Verknüpfungen passieren zufällig. Aus dem Zufall folgt die demokratische Natur der Banden: Die Gäste werden am Ende des Abends ungefähr gleich viele neue Leute direkt kennen gelernt haben. Nur ganz wenige Gäste werden sehr viel mehr Leute kennen und nur ganz wenige werden sehr viel weniger Leute kennen. Mathematisch gesprochen: Jeder Knoten (Gast) hat ungefähr gleichviel Verknüpfungen (neue soziale Banden).
Doch lassen sich Netwerke tatsächlich so beschreiben? Erdös und Rényi interessierte diese Frage wenig. Sie waren zufrieden mit der Eleganz ihrer mathematischen Lösung. Auch hätte es zu ihrer Zeit (die wichtigen Veröffentlichungen stammen aus den Jahren 1959/1960) keine Möglichkeit gegeben, die Theorie zu überprüfen, weil es kein empirisches Datenmaterial dazu gab. So dauerte es fast vierzig Jahre bis Albert-Lászlo Barabási, Physik-Professor an der Notre Dame Universität, die Ideen von Erdös und Rényi aufgriff, um sie am Beispiel des Internets zu testen. Die Knoten waren jetzt nicht mehr Gäste, sondern Webseiten. Und die Verknüpfungen waren nicht mehr soziale Banden, sondern virtuelle Links.
Das Internetz
Das Resultat seiner Internet-Analyse war völlig unerwartet: Einige Knoten hatten sehr viele Verknüpfungen (dies sind natürlich die Seiten, die fast jeder kennt wie Yahoo!, Google, Amazon etc.). Und viele Knoten hatten sehr wenige Verknüpfungen. So etwas wie eine durchschnittliche Verknüpfungsanzahl für die Mehrheit der Knoten ließ sich nicht angeben, weshalb der Physiker diese Netzwerke als skalenfrei bezeichnet. "Skalenfrei bedeutet aber auch, dass die virtuelle Welt undemokratisch gebaut ist", erklärt Barabási im Gespräch.
Auch zeigte sich, dass die Art, wie neu hinzukommende Knoten (Webseiten) Verknüpfungen (Links) eingehen, keineswegs zufällig ist. Es existiert eine bevorzugte Weise, wie sich neue Webseiten vernetzen. Und zwar vernetzen sie sich mit bereits gut bekannten Webseiten. Barabási nennt dies das Phänomen der Reichen, die noch reicher werden.
Er ist überzeugt, dass viele weitere komplexe Systeme einem ähnlichen Netzwerkmuster folgen. So etwa biochemische Prozesse im Körper. Mit seinen Ideen hat der Physiker mittlerweile die Aufmerksamkeit von Molekularbiologen und Medizinern auf sich gezogen. Kein Wunder, spricht er doch von einem "Paradigmenwechsel" in unserem Verständnis von Krankheiten. Die traditionelle Medizin behandle lediglich Symptome. "Wenn jemand Bluthochdruck hat, dann wird der Arzt den Blutdruck runterdrücken. Nach den Ursachen wird dabei gar nicht erst gefragt", erklärt der Netzwerktheoretiker die traditionelle Art der Medikation, die er eine kompensatorische nennt. "Um einen Vergleich zu bringen: Natürlich kann man ein Auto, wenn es ein kleines Loch im Tank hat, am Weiterfunktionieren halten, indem man ständig Benzin nachfüllt. Das behebt aber nicht die Ursache."
Und die Ursachen können mannigfaltig sein. Barabási veranschaulicht dies an einem weiteren Beispiel: "Wenn das linke, vordere Autolicht kaputt ist, kann das sein, weil die Glühbirne kaputt ist, oder aber der Draht, über den das Licht mit Strom versorgt wird, kann gebrochen sein, oder vielleicht ist auch der Schalter defekt, mit dem wir das Licht anschalten." Während die Mechaniker die einzelnen Knoten (Fahrzeugteile) und ihre Verknüpfungen (Art des Zusammenspiels der Fahrzeugteile) ganz genau kennen, wissen die Wissenschafter über den menschlichen Körper vergleichsweise wenig. Immerhin weiß man von einfacheren Organismen wie zum Beispiel den Hefezellen mehr. Durch Knock-out von einzelnen Molekülen etwa konnte Folgendes gezeigt werden: Wenn gut verknüpfte Moleküle abgeschaltet werden, ist dies zu 70 Prozent tödlich, bei weniger gut verknüpften nur zu 18 Prozent. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil der undemokratischen Verteilung der Molekülnetzwerke: Stark vernetzte Moleküle gibt es nur sehr wenige, die Wahrscheinlichkeit, dass sie beschädigt werden, ist entsprechend gering. Barabási spricht deshalb von der Robustheit von biologischen Systemen. Ob auf den Menschen zutrifft, was für die Hefezelle der Fall ist, wird die Zukunft zeigen.
Alte Daten, neue Sicht
Viele Informationen über das E.coli Bakterium hätte es schon seit Jahrzehnten gegeben. Allerdings verstreut in diversen Fachmagazinen. Als Nichtbiologe hätte man da kaum eine Chance gehabt, die Daten zusammenzusuchen. Und warum haben die Biologen selbst nicht die Daten gesammelt? "Weil sie nicht gewusst haben, was man aus den Daten alles herauslesen kann. Ihnen fehlten die mathematischen Werkzeuge." Barabási meint, dass bald eine junge Generation von Forschern auftauchen wird, die mathematische Kenntnisse und biologisches Wissen in sich vereint. Er als nur-Physiker sei dann bloß noch ein Relikt. Immerhin könnte er sich dann aber rühmen, ein neues Forschungsfeld mitbegründet zu haben. Das geschieht übrigens auch stets nach streng netzwerktheoretischen Gesetzmäßigkeiten. Dabei baut jemand eine Brücke zwischen zwei unabhängig von einander arbeitenden Forschungsgemeinschaften. Ein Link, eine kleine Revolution.
Online-Tipp: www.fas.at