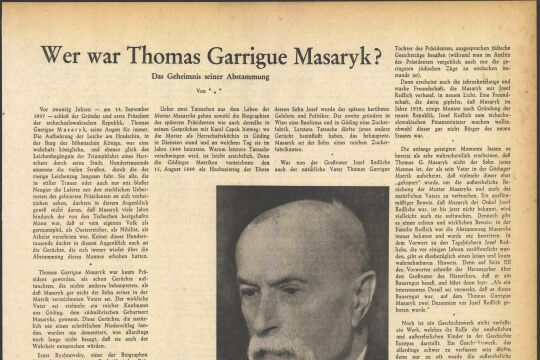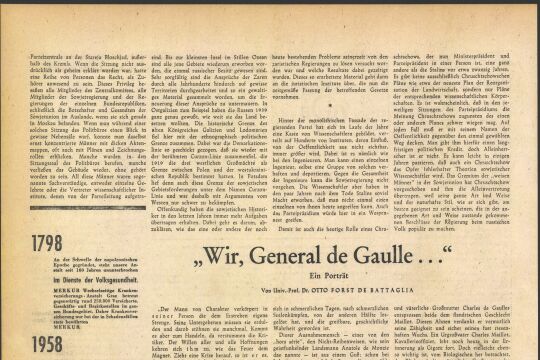Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
FILM
Kurz nach „Network” kommt auch jener Füm zu uns, der beim „Oscar”-Wettbewerb vor wenigen Wochen den Hauptpreis, nämlich die Auszeichnung für den besten amerikanischen Füm des abgelaufenen Jahres, gewonnen hat: „Rok- ky”. Er besitzt zwar nicht die geistige Brülanz von „Network” oder „Die Unbestechlichen”, aber er mag den Juroren aus mehreren Gründen mehr am Herzen gelegen sein.
„Rocky”, die Geschichte eines mittelmäßigen Boxers aus Phüa- delphia, der sein Brot mehr als Geldeintreiber im Sold eines Gangsters verdient und eines Tages unvermutet die Chance eines Weltmeisterschaftskampfes erhält, den er ehrenhaft nach Punkten verliert, ist in keiner Weise aggressiv oder polemisch. Der Film zeigt nicht einmal die schmutzigen Seiten des Berufsboxsports auf, er ritzt höchstens ein bißchen am Cassius- Clay-Kult und am Rummel um die 200-Jahr-Feier der USA. Dafür steUt er den Typus des schon verloren geglaubten positiven Helden heraus, der sich obendrein nicht nur als herkulisch gebauter, sondern auch als „schöner Mann” präsentiert - auch das war in den letzten Jahren ja kaum mehr gefragt. Dieser Rocky - möglicherweise war bei der Figur an Rocky Marciano, einen den ganz wenigen weißen Schwergewichtsweltmeister gedacht - geht mit hartem Training und ohne die üblichen Profimätzchen den Weg nach oben. Er weiß, daß er kaum eine Chance hat, den Titel zu gewinnen, aber er wül dem regierenden Weltmeister einen Kampf liefern, bei dem er nicht k.o. geht, und damit zum ersten Mal beweisen, daß er nicht irgendein Niemand ist. Auch nachdem er es geschafft hat, liebt er ebenso ehrlich wie bisher die Schwester seines einzigen Freundes, ein ehemaliges Mauerblümchen.
Eine etwas zu schöne, man könnte auch sagen: allzu simple und naive Story. Aber der Streifen apostrophiert mehrfach die USA als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und wül nach den Worten seines Hauptdarsteüers und Drehbuchautors Sylvester Stallone etwas vom „neuen Optimismus” der beginnenden Carter-Ära vermitteln. Formal ist er zweifeüos gute Klasse, aber nicht Spitze. Technisch ist er vor aüem in der brutalen Dramatik der Boxszenen ausgezeichnet, schauspielerisch besonders durch die junge Talia Shire und den alten Burgess Meridith in der Roüe eines ausgekochten Managers beachtlich. Regisseur John G. Avildsen ist uns allerdings durch „Save the tiger” in noch besserer Erinnerung, doch hatte er dort ein glänzendes Drehbuch und einen Jack Lemmon zur Verfügung.
Ein Füm von höheren geistigen Ansprüchen ist zweifeüos die italienisch-französisch-deutsche Produktion „Die Tatarenwüste”, nach dem gleichnamigen Roman des Italieners Dino Buzzati (1906-1972) gedreht. Es handelt sich hier um eine Parabel, die in einem am Rand der Wüste gelegenen Fort der k. u. k. Armee lokalisiert ist. Offiziere verschiedenen Ranges und Alters warten hier auf einen Feind, der nie kommt - jahrelang, und gehen so, eingeschlossen in eine kaf- kaeske Welt und deren Konventionen, an ihrem Leben vorbei. Die Suche nach dem Sinn des Daseins durchzieht diesen existenzialphüo- sophisch getönten Füm, den Valerio Zurlini (bekannt vor allem durch „Cronaca familiäre”) sehr subtü und mit großer Besetzung in Szene gesetzt hat: Max von Sydow, Helmut Griem, Giuliano Gemma, Jean-Louis Trintignant, Vittorio Gassman und Philippe Noiret verkörpern neben dem durch seine zusätzliche Funktion als Koproduzent offensichtlich überforderten Jacques Perrin die Hauptroüen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!