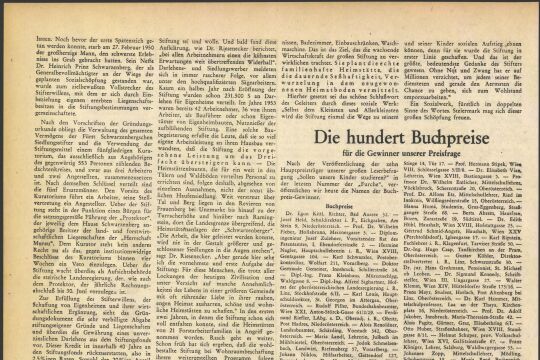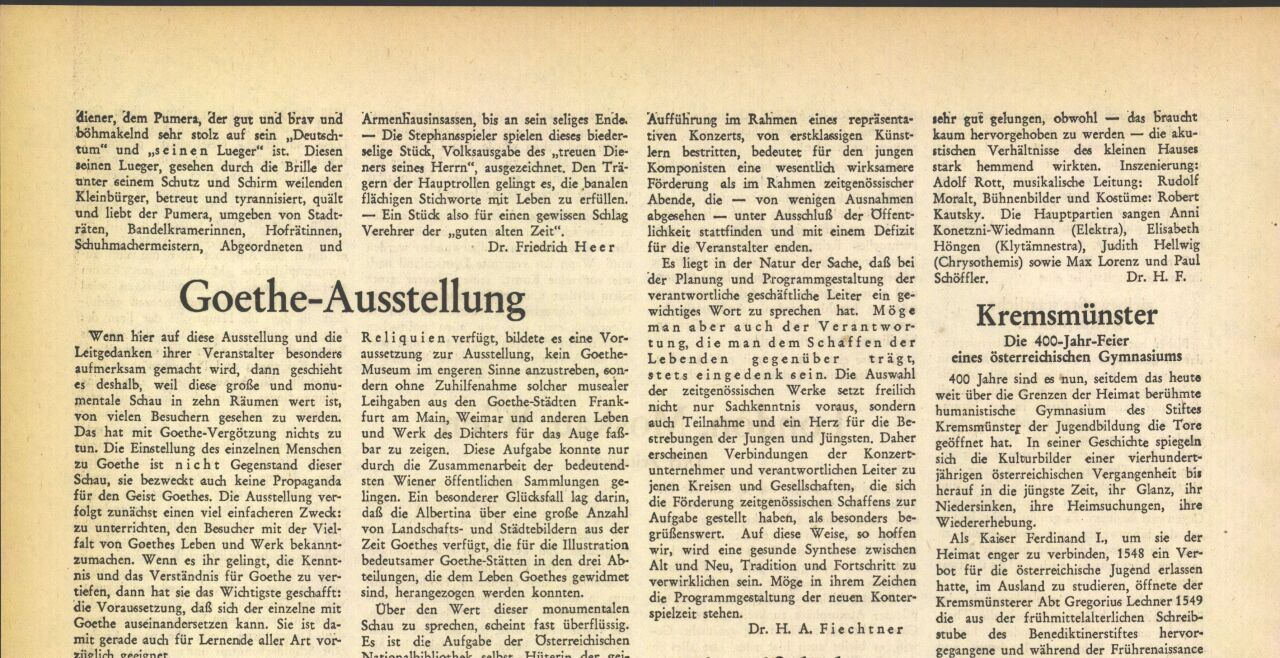
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein mißglücktes Regieexperiment
Neuinszenierung und Besetzung der „Elektra“ in der Staatsoper geben Anlaß zu einer Kritik, die um so bedauerlicher ist, als gerade diese Aufführung als Festgeschenk der Staatsoper zum 85. Geburtstag von Richard Strauß gedacht war. Als vor 40 Jahren die „Elektra“ in Dresden uraufgeführt wurde, waren sich Gegner und Anhänger des neuen Werkes darüber im klaren, daß hier von den beiden Künstlern Hofmannsthal und Strauß etwas Ungewöhnliches an Kompliziertheit, Ausdruck und Intensität versucht worden war. Als einen Grenzfall des auf einer Opernbühne eben noch Erträglichen empfinden wir das Sujet auch heute noch. Über die künstlerischen Qualitäten der Straußschen Musik kann man geteilter Ansicht sein, doch sollen diese im Augenblick nicht diskutiert werden. Es geht um die Neuinszenierung, welche das Werk vergröbert und zum Teil verfälscht. Dabei stellen wir uns nicht auf den Standpunkt des Musikphilologen, der jeden Hilfsgriff des Regisseurs von vorne- herein ablehnt; in diesem Falle aber bedeutet jede Abweichung von den Regievorschriften eine Verschlechterung. Denn zwei so eminente Künstler und Bühnenpraktiker wie Hofmannsthal und Strauß bedürfen keiner Hilfe von selten des Regisseurs. Diese riesige, wie eine Zugbrücke an dicken Seilen befestigte Falltür aus Glas in einem Raum, am ehesten dem Innenhof der Reichskanzlei vergleichbar, ist ein Unding. In ihr verschwindet, wie in einem feuerspeienden Orkus, der Opferzug, welcher nach der Regieanweisung Hofmannsthals — eine grausig-eindrucksvolle, aber kurze Episode — „an den grell erleuchteten Fenstern“ vorüberzieht. Dahinein wird auch Aegisth gezerrt, dessen Ermordung sich im Innern des Palastes ereignen soll. Solcher Gewaltsamkeiten gibt es mehrere. Was bedeutet zum Beispiel der Feuerschein, der durch die besagte Glastür auf die Bühn fällt? Zugunsten des Regisseurs wollen wir annehmen, daß all diese Dinge nicht seinem eigenen Konzept entspringen, sondern daß er sich entschlossen hat, aus der Not ein Tugend zu machen, das heißt die Bühne durch Feuerschein und Projektoren in ständiger optischer Bewegung zu halten, da die Hauptdarstellerin sehr statisch ist. Auch bei ihr wäre es verfehlt, eine bestimmte künstlerische Absicht, etwa im Sinne einer Stilisierung auf das Wagnersche Musikdrama oder die Auffassung der Antike durch Winckelmann und Goethe anzunehmen. Die ausgezeichnete Sängerin, welche die schwierige Partie der Elektra musikalisch hervorragend bewältigt, ist für die Darstellung dieser Rolle denkbar wenig geeignet und erfüllt damit leider nur die Hälfte ihrer Aufgabe. Neben ihrer massiv-ruhigen Erscheinung wirkt daher auch die Gestalt der Klytämnestra unruhig-hysterisiert und keine Spur mehr königlich. — Die Lehre, die aus dieser mißglückten Neuinszenierung zu ziehen wäre, ist ebenso zwingend wie einfach: daß man ein Werk wie „Elektra" nur geben kann, wenn die Hauptpartie entsprechend zu besetzen ist. Der musikalische Teil der Aufführung war besser, teilweise ehr gut gelungen, obwohl — das braucht kaum hervorgehoben zu werden — die akustischen Verhältnisse des kleinen Hauses stark hemmend wirkten. Inszenierung: Adolf Rott, musikalische Leitung: Rudolf Moralt, Bühnenbilder und Kostüme: Robert Kautsky. Die Hauptpartien sangen Anni Konetzni-Wiedmann (Elektra), Elisabeth Höngen (Klytämnestra), Judith Hellwig (Chrysothemis) sowie Max Lorenz und Paul Schöffler.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!