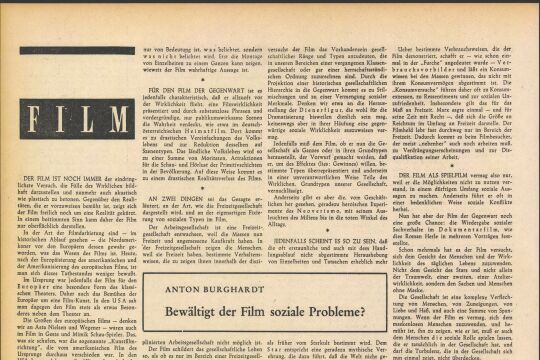Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Amerikanische Starfilme
„Der Stadtneurotiker“ ist der nicht sehr glückliche Titel für den jüngsten Woody-Allen-Film, der im Original einfach „Annie Hall“ heißt, womit eine Sängerin bezeichnet ist, welche die letztlich unerfüllte Liebe des Titelhelden bleibt.
Woody Allen, der gar nicht schöne, bebrillte Komiker, ist in den letzten Jahren mit Filmen wie „Mach’s noch einmal, Sam!“, „Der Schläfer“ und „Die letzte Nacht des Boris Gruschenko“ auch bei uns sehr populär geworden und hat in „Der Strohmann“, einer Abrechnung mit den McCarthy-Umtrieben, bewiesen, daß er auch ein ernst zu nehmender Charakterdarsteller ist. „Der Stadtneurotiker“ ist vielleicht nicht der beste, aber sicher der persönlichste Film Aliens. Denn die Geschichte eines Komikers, der ein Bündel von Komplexen, nicht zuletzt sexueller Natur, und daher Stammgast beim Psychiater ist, weist eindeutig auf autobiographische Züge hin. Dabei deklariert sich Allen gleich eingangs als geistiger Erbe des kürzlich verstorbenen Graucho Marx, mit dem ihn vor allem der sarkastisch-hintergründige Wortwitz eines lebendigen, kritisch beobachtenden Großstadtintellekts verbindet. Ein Witz, der manchmal in philosophische Tiefen über Leben, Liebe, Gesellschaft und Tod geht und sich auch spezieller formaler Mittel bedient, um an den Beschauer heranzukommen: Einblenden von Zwischentiteln, um die Gedanken des Helden zu veranschaulichen, Einschaltung von Zeichenfilmen und das öftere direkte Ansprechen des Publikums.
Mitunter ist aber dieser Humor auch krampfhaft gequält, das Feuerwerk an Pointen verpufft allmählich und ermüdet den Beschauer, dem eine soziale Wirklichkeit durch Aliens Brille in einer sehr pessimistischen Sicht geboten wird. Insgesamt ein mit viel Hirn, aber weniger Herz gemachter Film, dem in einer Szene mit einem Fellini-Fan eine besonders köstliche Passage gelungen ist
Wie leicht ein starbestückter, aufwendiger Streifen danebengeraten kann, demonstriert der Hollywood-Film „New York, New York“, den Martin Scorsese(zuletzt „Taxi Driver“), eines der jüngsten Wunderkinder der amerikanischen Filmproduktion, inszeniert hat. Sein Film spielt im Show-Business der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, das er an Hand der unhappy endenden Ehegeschichte zwischen einem Saxophonspieler und einer Jazzsängerin ausgiebig beleuchtet Aber Scorsese hat eine recht komplexe Story gebaut und neben dem Hauptkonflikt des Musikerehepaares, das sein Verhältnis zwischen Karriere und Liebe nicht koordinieren kann, noch so viel an Themen hineingepackt daß dies den Film einfach überfrachtet und letzten Endes erdrückt. So sind Scorsese in seinem mit zweieinviertel Stunden sicher auch zu lang ausgefallenen Film am ehesten einige aufwendig ausgestattete Musikszenen gelungen.
Immerhin standen dem Regisseur zwei Topstars zur Verfügung. Von ihnen ist Liza Minnellienttäuschend. Sie kopiert ihre Mutter Judy Garland, doch war diese im gleichen Alter doch besser, und ich furchte sehr, daß die Minnelli ihre fulminante Leistung von „Cabaret“ kaum mehr erreichen wird. Ihr Partner ist der wieder sehr wand, lungsfähige, ausgezeichnete Robert de Niro, der ja erst kürzlich mit „Taxi Driver“ einen Welterfolg hatte. Aber er spielt in den letzten Jahren, wenn auch vorerst noch meist vorzüglich, derart viel, daß man auch um seine künstlerische Entwicklung bangen muß.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!