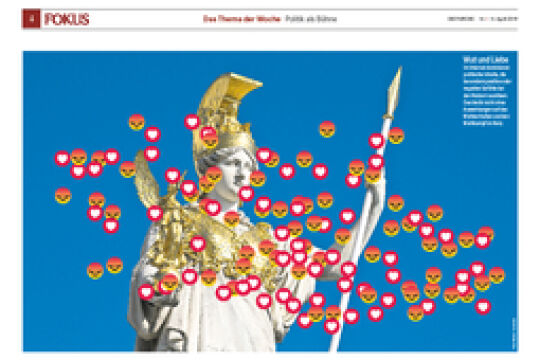Er fühlte sich als Robin Hood des 21. Jahrhunderts, doch das Imperium, mit dem sich der Rebell aus Wien anlegte, schlug sofort zurück: Im August des Vorjahres stellte Ch. R. die neue, damals noch unveröffentlichte CD der amerikanischen Pop-Diva Madonna zum kostenlosen Download ins Internet. Jeder, der davon wusste, konnte sich das neue Album gratis auf seinen Computer herunterladen, noch bevor es in den Geschäften zu haben war. Doch auch der Musikkonzern Warner, bei dem Madonna unter Vertrag steht, bekam Wind von dieser Internetseite. Einen Monat später bekam R. Besuch von der Wirtschaftspolizei, nun wurde er vom Wiener Straflandesgericht zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Seine Computerfestplatten, sein CD-Brenner und Kopien von 1.600 Alben, die bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden waren, werden vernichtet. "Wir werden auch in Zukunft gegen Musikpiraterie vorgehen", betonte Manfred Wodara, stellvertretender Geschäftsführer von Warner Music Austria, nach der Urteilsverkündung.
Milliardenverluste?
"Musikpiraterie" - mit diesem Begriff reagiert die Musikindustrie auf eine Entwicklung, die sie komplett verschlafen hat. Binnen eineinhalb Jahren hat das Internet das traditionelle Musikgeschäft in seinen Grundfesten erschüttert und die Musikindustrie versäumte es, die neuen, für Musikliebhaber höchst attraktiven Möglichkeiten des Internets für sich zu nutzen: Heute kann jeder, der einen Computer zu Hause stehen hat, kostenlos Musik aus dem Internet auf seine Festplatte herunterladen - die aktuellen Hits ebenso wie südamerikanische Oldies, finnische Volksmusik ebenso wie Verdi-Arien. Manche stellen ideologische Gründe in den Vordergrund - "Informationsfreiheit" -, die meisten wollen einfach nur schnell und bequem zu Musik kommen.
Die täglich millionenfach getätigten Downloads betrachtet die Musikindustrie freilich als illegal, denn Plattenfirmen, Verwertungsgesellschaften und Musiker lukrieren daraus keinen Groschen. Die Verluste, rechnet die Musikindustrie vor, gehen in die Milliarden. Noch größer ist der Imageschaden: Die ohnehin ungeliebte Musikindustrie steht plötzlich als verschnarchter Verein da, der den Anschluss an die Gegenwart verpasst hat.
Wie mit Musik im Internet umgegangen werden sollte, dafür fehlten bis zuletzt brauchbare juristische Regelungen. In der vergangenen Woche sind nun zwei erste Entscheidungen gefallen, die einen rechtlichen Rahmen für die Verbreitung von Musik im Internet vorgeben: n Ein US-Gericht hat entschieden, dass die Internet-Musiktauschbörse Napster keine durch das Urheberrecht geschützte Musik mehr kostenlos vermitteln darf. Napster ist mit 57 Millionen registrierten Nutzern das populärste jener Unternehmen, über die gratis Musik aus dem Internet heruntergeladen werden kann. Täglich offerieren und suchen dort - zu jeder Tages- und Nachtzeit - 6.000 bis 10.000 Menschen Musikdateien aller Art. Am Wochenende vor dem Urteil waren es doppelt so viele, an diesen beiden Tagen wurden angeblich 250 Millionen Titel downgeloadet.
n Das Europaparlament hat ein EU-Gesetz über das Urheberrecht im digitalen Zeitalter angenommen. Dieses Gesetz regelt, unter welchen Bedingungen urheberrechtlich geschützte Werke im Internet kopiert werden dürfen. Angesichts der Unsummen, um die es dabei geht, fand im Vorfeld ein "noch nie dagewesenes Lobbying" statt, wie die österreichische Europaabgeordnete Maria Berger (SPÖ) ächzte. Passiert das Gesetz auch den EU-Ministerrat, wird in Zukunft das Kopieren von Werken ohne Zustimmung des Autors bis auf wenige Ausnahmen verboten sein. Kopien für den Privatgebrauch werden, anders als von der Musikindustrie gefordert, auch in Zukunft erlaubt sein. Ebenfalls gestattet wird die Herstellung temporärer Kopien, um Werke im großen Rahmen im Internet verbreiten zu können - ein Punkt, an dem sich die Hilflosigkeit der traditionellen Musikindustrie dem neuen Medium gegenüber besonders krass offenbarte: Um ein Konzert im Internet übertragen zu können, müssen die Bilder über mehrere Server laufen, ein einziger wäre sofort überlastet. Stur hatte etwa der amerikanische Musikverlegerverband NMPA darauf beharrt, auch für diese flüchtige Vervielfältigung Gebühren einzuheben.
Aussichtsloser Kampf Ihren Ausgang nahm die heute kulminierende Entwicklung im bayrischen Erlangen. 1993 entwickelten Wissenschaftler des dortigen Fraunhofer-Instituts ein Programm namens MP3, das es gestattete, Musikdateien, wie sie sich auf jeder CD befinden, auf ein Zehntel ihrer Größe zu komprimieren. Eine Minute Musik im MP3-Format entspricht etwa einem Megabyte - eine Größenordnung, in der Daten relativ schnell via Internet transportiert werden können. Branchenkennern zufolge ist 1998 ein australischer Hacker in die Fraunhofer-Computer eingedrungen und hat dort das MP3-Programm "gezogen", wie das im Fachjargon heißt.
Rasend schnell verbreitete sich das Programm im Netz. Jugendliche Internet-Freaks wandelten die Musik auf ihren Lieblings-CDs in MP3-Dateien und stellten sie ins Internet. Statt wie früher mittels Tonbandcassetten, tauschen Jugendliche Musik in Form von MP3-Dateien über das Internet.
Das erste Unternehmen, das den Tausch von Musikdateien im großen Stil ermöglichte, war MP3.com. Die amerikanische Firma entwickelte eine Software, mit der jeder MP3-Dateien herstellen, diese auf der MP3.com-Homepage zum kostenlosen Herunterladen zur Verfügung stellen konnte und seinerseits alle von anderen offerierten Musikstücke herunterladen konnte.
Die US-Musikbranche klagte rigoros. Die vier großen, "Majors" genannten Musikkonzerne Universal, Warner, BMG und Sony, die 80 Prozent des Weltmusikmarktes kontrollieren, stellten Schadenersatzansprüche in der Höhe von Hunderten Millionen Dollar. MP3.com wurde von einem Gericht des Verstoßes gegen das Urheberrecht schuldig gesprochen, das Internet-Unternehmen und die Majors einigten sich 1999 auf einen Vergleich. Schon damals schrieb das Musikmagazin "Rolling Stone": "Der Kampf gegen die MP3-Hydra ist wohl niemals endgültig zu gewinnen."
Zur gleichen Zeit stieg der 19-jährige Student Shawn Fanning mit seiner Erfindung Napster ins Internet ein. Napster funktioniert nach dem Prinzip einer Tauschbörse: Die Mitglieder bieten die MP3-Dateien, die sich auf ihren Festplatten befinden, allen anderen zum Herunterladen an. Napster selbst speichert auf seinen Servern keine Musik, sondern teilt jedem User mit, wer gerade jenes Musikstück anbietet, das er sucht. "File-sharing" wird dieses Prinzip genannt. Sucht man zum Beispiel "Oops, I did it again" von Britney Spears, so erhält man eine Liste von 100 anderen Napster-Mitgliedern, die gerade Online sind und den Song auf ihrer Festplatte haben, gibt man "Das tu ich alles aus Liebe" von Peter Alexander ein, so bekommt man immer noch eine Liste von zehn Usern. Per Mausklick kann man dann das gesuchte Stück herunterladen - und in einem Fenster am Bildschirm beobachten, wie andere etwas von der eigenen Festplatte downloaden.
Napster verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Computernetze amerikanischer Universitäten brachen zusammen, weil sich Tausende von Studenten in ihrer Freizeit auf der virtuellen Tauschbörse tummelten.
Ende 1999 klagten der Verband der Amerikanischen Musikindustrie RIAA und die Majors Fannings Unternehmen wegen Verletzung der Urheberrechte, jene Klage, der nun endgültig stattgegeben wurde. Die Musikindustrie rechnete vor, dass ihr durch Napster Einnahmen in der Höhe von 300 Millionen Dollar (4,43 Milliarden Schilling) entgingen. Thomas Böhm, Sprecher des Verbandes der österreichischen Musikwirtschaft spricht vom "Diebstahl geistigen Eigentums": "In Musikwerke werden Monate, Jahre, Geld und Kreativität gesteckt. Für diese Leistung wollen wir eine Gegenleistung", bringt er den Standpunkt der Musikindustrie auf den Punkt. Vier Fünftel aller Musikproduktionen spielen ihre Produktions- und Vermarktungskosten nicht ein, argumentiert Böhm, diese müssten mit den gewinnbringenden Hits finanziert werden. Die Einnahmen, die der Musikindustrie durch das illegale Herunterladen entgingen, stellten dieses System in Frage, sagt der Sprecher des österreichischen Ablegers der International Federation of the Phonographic Industry (ifpi).
In Wirklichkeit entstünden der Musikindustrie gar keine Verluste, argumentiert hingegen Napster. Und überhaupt: das Tauschen von Dateien diene nicht kommerziellen Zwecken und sei daher kein Fall für das Urheberrecht. Laut einer Mitglieder-Umfrage erklärten 80 Prozent der Napster-User, nach wie vor CDs zu kaufen, zum Teil sogar häufiger als zuvor. Auch bei einer Umfrage des "Rolling Stone" gestanden nur acht Prozent der Leser, sie hätten ihre CD-Anschaffungen eingeschränkt, weil sie ihre Musik nur noch über das Internet bezögen. 54 Prozent gaben an, ihr Kaufverhalten nicht geändert zu haben, mehr als jeder Dritte kauft nach eigenen Angaben mehr CDs als vor seinem Einstieg in eine Internet-Tauschbörse.
Stars bangen um Geld Auch die Musiker sind, scheinbar über alle ideologischen Gräben hinweg, gespalten "Wenn ich von neun bis fünf Uhr arbeite, will ich dafür ein Gehalt", sagt der amerikanische Skandal-Rapper Eminem: "Mit Musik ist es das gleiche. Wenn ich meine Zeit da reinstecke, möchte ich dafür meinen Lohn." Der französische Synthie-Veteran Jean-Michel Jarre und die irische Kommerzrockband The Corrs überreichten vor einem halben Jahr eine von 1.400 Musikern unterschriebene Petition an das EU-Parlament, die unter anderem das Aus für Privatkopien verlangte. Im April 2000 klagte die Heavy Metal-Gruppe Metallica Napster und forderte die Betreiber auf, all jene Nutzer zu sperren, die sich Metallica-Nummern heruntergeladen hatten. Napster gab klein bei und verbannte genau 317.377 User. Für Metallica ging der Schuss allerdings nach hinten los: Dass die Band, die in ihrem Auftreten und ihrer Musik den Gestus des Rebellischen zelebriert, ganz spießig auf ihren bürgerlichen Rechten beharrte, verziehen ihr viele Fans nicht.
Andere Künstler zeigen kein Verständnis für die Musikindustrie: "Wenn die einzige Möglichkeit, einige gute Songs aus den siebziger Jahren zu bekommen, darin besteht, überteuerte Sampler mit einem hässlichen Cover und jeder Menge schlechter Songs zu erwerben und man noch nicht einmal weiß, ob die Künstler überhaupt Geld damit verdienen, muss man sich nicht wundern, dass sich die wirklichen Musikliebhaber für alternative Wege des Musikbezugs interessieren", meint etwa der amerikanische Popstar Prince. Die Underground-Rocksängerin Courtney Love, die mit ihrer Plattenfirma im Clinch liegt, möchte ihre Musik nur noch im Internet verbreiten. Nicht die kostenlose Verbreitung von Titeln im Internet, sondern die viel zu geringe Bezahlung der Künstler durch die Musikkonzernen sei die wahre Piraterie, schimpft die streitbare Sängerin.
"Ich sehe das Internet nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung", meint Peter Hartwig, Mitglied des Wiener Elektronik-Duos Bask. Er freut sich, wenn Stücke von seinen CDs im Internet kursieren und weiß auch, dass das Internet für viele Kollegen ohne Plattenverträge eine wichtige Plattform darstellt.
Bald legale Angebote?
"Aus der Sicht des Musikförderers ist diese Auseinandersetzung für die zahlenmäßige Mehrheit der Künstler esoterisch", sagt Peter Rantasa, Leiter des Music Information Centers Austria (mica). Der Chef dieser Organisation, die sich als neutrale Kommunikationsplattform für die Akteure des Musiklebens definiert, weiß, dass nur wenige Musiker von den Erlösen aus dem Urheberrecht leben können. "Für die Stars ist ein Tonträger wie ein Geldschein und Geld zu kopieren ist eine Straftat" vergleicht mica-Urheberrechtsexperte Bernhard Guenther: "Für die meisten Musikschaffenden, mit denen wir zu tun haben, ist ein Tonträger eine Visitenkarte; wenn die in Umlauf gerät, hat das sehr viel Positives."
Obwohl Napster in der derzeitigen Form nur noch wenige Wochen existieren wird, sind diese Diskussionen noch lange nicht ausgestanden. Denn von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt sind im Internet rund ein Dutzend andere Möglichkeiten zum Austausch von Musik entstanden, wie etwa Gnutella, Freenet, Mojo Nation oder Song Spy. Dieser neuen File-Sharing-Netze Herr zu werden, wird für die Musikindustrie noch schwieriger. Denn im Unterschied zu Napster kennt zum Beispiel Gnutella keinen zentralen Server, auf denen ein Index aller zur Verfügung gestellten Musikdateien bereitgehalten werden. Bei derartigen "Peer to Peer"-Netzen ist jeder Computer gleichwertiger Sender und Empfänger. Gnutella selbst ist eigentlich nur ein Programm, es gibt also niemanden, den die Musikindustrie als Drahtzieher verantwortlich machen könnte.
Viele der bisherigen Napster-Mitglieder haben nun angekündigt, zu Gnutella & Co zu wechseln, die Chat-Foren sind voll mit Beschimpfungen der Musikindustrie und Tipps einschlägiger Internet-Adressen. "Jetzt ist die Zeit gekommen, der gierigen Musikindustrie zu zeigen, wo sie uns mal kann. Treffen wir uns doch einfach auf einer anderen Gratisplattform!", hieß es etwa im Standard-Online-Newsroom. Es sind dies jene zumeist jugendlichen Computerfreaks, die einem von der Realität schon längst überholten Idealbild des Internets nachhängen: ein virtueller Kosmos ohne Geschäftemacherei, in dem sich jeder jede Information kostenlos beschaffen kann. Sie rufen "Informationsfreiheit" meinen in Wirklichkeit jedoch allzu oft: Freibier.
Auch die großen Musikkonzerne wollen nun auf den Zug aufspringen und einen legalen Handel mit MP3-Dateien im Internet aufbauen. Im Oktober des Vorjahres ist der Bertelsmann-Konzern, zu dem BMG gehört, bei Napster eingestiegen und möchte das einstige Piratenflaggschiff ab Juni in einen kostenpflichtigen Abonnementservice umbauen. Laut Bertelsmann-Untersuchungen sind 76 Prozent der bisherigen Napster-User bereit, eine monatliche Gebühr zu bezahlen, um legal und in guter Qualität Musikstücke aus dem Internet herunterzuladen. "Wir machen es den Leuten wirklich schwer, legal an Musik im Netz zu kommen", gesteht Andreas Schmidt von der Bertelsmann E-Commerce Group ein.
Einfach wird das nicht. Für ein praktikables Business-Modell für den Handel von MP3-Dateien im Internet müssen die Verträge mit den Künstlern geändert, die Technologie entwickelt und international verbindliche rechtliche Grundlagen geschaffen werden. "Ein riesiges Projekt, das nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist", seufzt ifpi-Sprecher Thomas Böhm, der aber überzeugt ist: "Wenn es gute legale Angebote gibt, werden die meisten Leute nicht auf illegale zurückgreifen."
Sollte es allerdings nicht gelingen, schnell ein gutes legales Service aufzubauen, das ein mindestens so reichhaltiges Musikangebot wie Napster zur Verfügung stellt, dann könnte die Musikindustrie endgültig ins Wanken geraten. Wenn die überteuerten, offiziellen CDs über Jahre mit kostenlosen, illegalen Internet-Downloads konkurrieren, dann werden jene finanziellen Verluste, welche die Musikindustrie jetzt bejammert, schließlich doch Wirklichkeit werden.