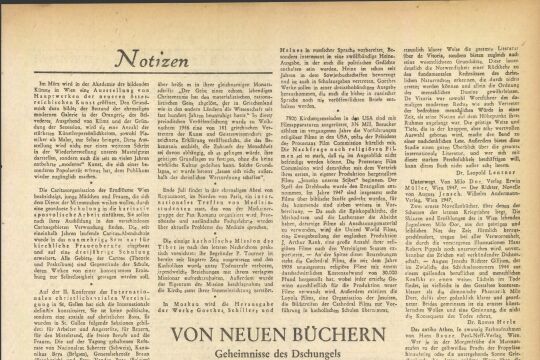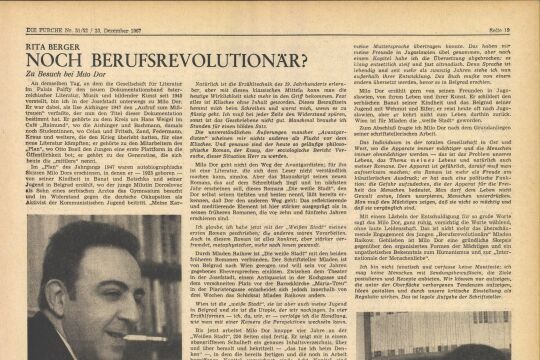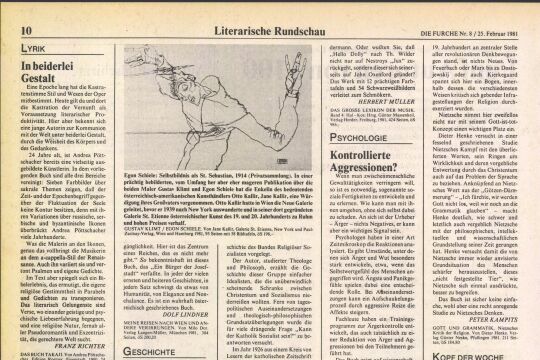Unter den jungen Menschen, die mit hungrigem Magen und gezeichnet von den sieben düsteren Jahren 1945 tatenfroh einen neuen Tag begrüßten, fiel ein junger Mann mit schwarzer Haarmähne, dunklem Typ und der in Wien stets wohlverstandenen slawischen Klangfarbe der übrigens einwandfreien deutschen Aussprache bald auf. In den zahlreichen literarischen Runden, Studentenklubs und Künstlerkreisen jener Jahre wurde er bald Milo Dor gerufen. Dieser abgekürzte Name blieb dem jungen Serben, der ein typischer Vertreter der „Uebrig- gebliebenen”, der im zweiten Weltkrieg gereiften und von ihm nach langer Irrfahrt an ein neues Ufer geworfenen Generation war. Der Belgrader Gymnasiast war, wie es zur jener Zeit in seiner Heimat für junge Intellektuelle geziemte, linksradikal eingestellt gewesen. Die deutsche Besatzung förderte diese Neigung. Die Polizei des mit der Besatzungsmacht kollaborierenden Generals Nedic versuchte, dem jun-
gen Mann diese Ueberzeugung aus dem Leib zu prügeln. Was dann kam, war aber noch ärger. Als Milo Dor die Abkehr Titos von Moskau für sich privat um Jahre vorwegnimmt, gerät er bei seinen Partisanengenossen in den Verdacht des Verrates. Letzter Ausweg in dieser doppelten Bedrängnis: er läßt sich als „Fremdarbeiter” nach Wien abschieben — der jahrhundertealten Fluchtbuig nicht weniger Serben vor drückender Fremdherrschaft und den Stammesfehden zu Hause. Hier trifft ihn das Jahr 1945 an, hier erreicht ihn die Rote Armee. Die Reste kommunistischer Sympathien verflüchtigen sich bei dieser Begegnung. Zurück bleibt die Seelenwüste des Nihilismus. Nach der „Sonnenfinsternis” zeigt sich der schwarze Stern Jean Paul Sartres am Horizont.
Woher wir das alles wissen? Milo Dor hat uns das selbst in seinem autobiographischen Roman „Tote auf Urlaub” verraten, dessen Manuskript in jenen ersten Wiener Nachkriegsjahren entstand, lange aber von Verlag zu Verlag wanderte, bis es — bezeichnenderweise — 1952 ein deutscher Verlag herausbrachte. Ohne Zweifel ein Beitrag zur „harten Literatur”, randvoll von breit ausgemalten naturalistischen Schilderungen aus den Jahren, wo der Mensch dem Menschen ein Wolf war. Die einfache, kraftvolle Sprache aber riß mit, sie machte auf den weiteren Weg des sich ohne Zweifel zum Romancier legitimierten jungen Mannes neugierig.
Doch man mußte lange warten. Genau genommen bis heute. Das heißt nicht, daß der Name Milo Dor in Vergessenheit geraten war. Man las ihn vielmehr oft, zu oft unter Kolportagegeschichten, wie sie die ewig hungrigen, finanzkräftigen Illustrierten so notwendig brauchen und fürstlich honorieren. Oft stand daneben auch der Name eines literarischen Kollegen. Milo Dor war in die Konfektion gegangen. Er hatte nicht nur mit seinem Kompagnon eine’ kleine Literaturfabrik aufgemacht, er hatte dadurch — auch das ist bezeichnend für nicht wenige enttäuschte Idealisten jener Generation in einer Gesellschaft, die den theoretischen Materialismus angeblich bekämpft, den angewandten aber lebt — den Ausweg im „Geschäft” gesucht und gefunden.
Doch nun kehrt Milo Dor wieder. Es ist die Heimkehr des (beinahe schon) verlorenen Sohnes in das Vaterhaus der Literatur. Laßt uns fröhlich sein und das berühmte Kalb schlachten. Der vorliegende Roman verdient es. Es ist ein stilles, ein sehr sympathisches Buch. Milo Dor geht, wiederum in leicht zu entschlüsselnder Autobiographie, den Weg zurück. Weit hinter seiner stürmischen Jugend liegt das Land der Kindheit, noch weiter zurück die in Wellen am Horizont der Geschichte sich verlierende Landschaft einer serbischen Familie im ehemals der Donaumonarchie zugehörigen .Banat. Prachtvolle Menschenbilder entstehen, tragikumwitterte Gestalten, seltene Käuze, liebenswürdige Tagediebe — alles in allem aber: Menschen, die ohne den Hintergrund des Landes, das sie hervorbrachte, undenkbar wären. — „Das alles war einmal Leben gewesen, und jetzt war es nichts als Erinnerung, die immer schwächer und flüchtiger wurde.”
Es hätte nicht dieses Schlußsatzes bedurft, uns es offenbar zu machen: Milo Dor, der als verhinderter Leitartikler auszog, kehrt als verschämter Idylliker wieder. Und noch etwas. Das vorliegende Buch ist „Für meinen Vater und meinen Sohn” — so steht es in der Widmung — geschrieben. Milo Dor hat, nach der Enttäuschung mancher geistigen und anderen Abenteuerfahrt, Zuflucht in der erprobten uralten Bindung seines Volkes gefunden: in der Familie.
Milo Dors Wiederkehr als Idylliker!
Bleiben wir noch kurz bei diesem Gedanken: Ein Wortführer der tatenlustigen, von Plänen erfüllten jungen Generation von 1945 singt in unserem „Neon-Biedermeier” von 1959 nichts anderes, als leicht resignierend das alte Lied „Es war einmal ...” Nicht wenige Angehörige der „Kriegsgeneration” singen in ihrem Leben heute ähnliche Melodien. Genau genommen: ein’großer Vorwurf für ein Buch. Wer schreibt den Roman der jungen österreichischen Generation von 1945, ihren Hoffnungen und Enttäuschungen? Herbert Eisenreich hätte das Zeug dafür, oder Gerhard Fritsch — vielleicht Milo Dor selbst? Seine Wiederkehr in die Literatur darf jedenfalls kein einmaliges Gastspiel bleiben.