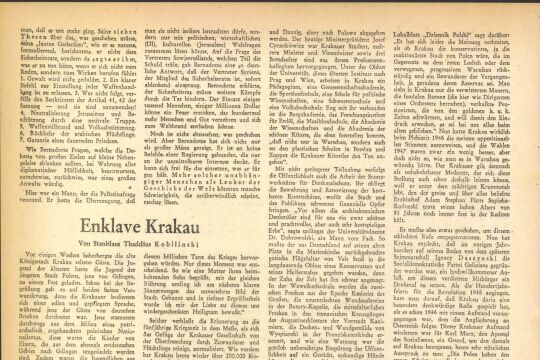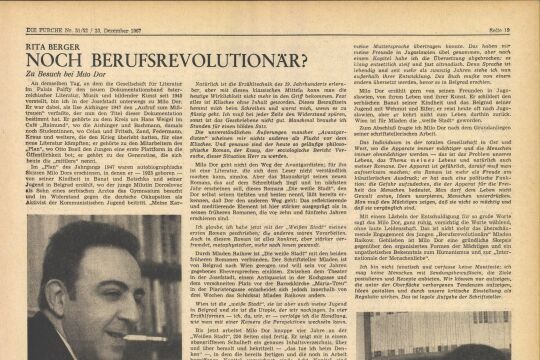Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Falsche Propheten
Die kurze Geschichte hat nicht wirklich viel Handlung, diese ist daher schnell erzählt. In einem großen Fußballstadion beginnt sie, einem Stadion, das 70.000 Menschen fassen kann, aber nicht alle, die gekommen waren, „um Karl Haselgru-ber zu hören.” (7) Der Ich-Erzähler traut sich nicht hineinzugehen und nimmt vor dem Stadion auf der Wiese Platz, will den Führer der neuen Bewegung hören und auch wieder nicht, sucht schließlich ein Gasthaus auf, schließt mit dem Wirt, der wie er Ausländer ist, Freundschaft, hinter Fenstern, die nach Krawallen gegen Ausländer provisorisch mit gekreuzten Brettern zugenagelt sind, und geht schließlich nach Hause, wo er mit seiner Frau nur bei laufendem Wasser oder Fernseher sprechen kann, da er sicher sein muß, abgehört zu werden. Nach einem gescheiterten Versuch, eine Bosnierin und ihre Tochter vor den Behörden in eine Kirche in Sicherheit zu bringen, beschließt der Ich-Erzähler, der sich inzwischen als Mladen Baikow vorgestellt hat, mit seiner Frau auszuwandern, nicht ohne zuvor mit ihr sogar die Möglichkeit eines gemeinsamen Selbstmordes besprochen zu haben.
Was ist passiert mit Osterreich, mit Wien, der Stadt, in der dieser Ich-Erzähler lebt, im Juli 1999, der Zeit, in der diese Geschichte stattfindet?
1998 haben Wahlen einer neuen rechtsradikalen Bewegung Macht gegeben, und seitdem hat sich einiges geändert: Ausländer werden gekündigt und abgeschoben, die Todesstrafe wurde wieder eingeführt, und Basterfahndung und Lauschangriff ermöglichen dem Staat die lückenlose Kontrolle vor allem über unliebsame Elemente, wie Raikow eines ist. Dieser Schriftsteller, der als Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Wien kam und da blieb, hat schon mehr als eine Diktatur, mehr als ein terroristisches Regime erlebt und es durch die Folter auch an der eigenen Haut erlebt, im wahrsten Sinn des Wortes, und daher allen Grund zu warnen vor der Dritten Republik, die er im Anmarsch begriffen sieht. Doch umsonst. Die Warner werden stumm, die Massen stärker und setzen sich durch.
Was auf ihn, den Regimekritiker, den das der Bewegung nahestehende kleinformatige Massenblatt „Die serbisch-kosmopolitische Schmeißfliege am gesunden Volkskörper” (7) nannte, zukommen wird, kann er nur ahnen, und ein Blick in die Vergangenheit genügt, ihm zu sagen, daß er all das, was er schon mitgemacht hat (Folter, Mißhandlung, Strafgefangenenlager) nicht noch einmal mitmachen möchte. „Ich habe es satt, nach einem halben Jahrhundert noch immer als Fremder angesehen zu werden.... Ich werde einfach weggehen, weil ich unter freundlichen Menschen sterben möchte. ...” (113f), so sagt er seinem Freund, und weiter: „Irgendwo muß es doch ein Land geben, in dem ein Fremder kein Fremder ist, sondern ein willkommener Gast.” (14)
Dor-Leser kennen Raikow bereits. Nach ihm ist ja die Romantrilogie benannt, die das lieben dieser mit autobiographischen Zügen versehenen Figur schildert. In den drei Romanen „Tote auf Urlaub” (1952), „Nichts als Erinnerung” (1959) und „Die weiße Stadt” (1969) hat Dor nicht nur das lieben einer fiktiven Figur erzählt, sondern das einer Generation im Widerstand, im 20. Jahrhundert, das „wahrlich nicht arm an Massenbewegungen, die mit brutaler Unterdrückung der Andersdenkenden, mit Kriegen und Massenmorden einhergingen” (60), war.
Der Serbe Mladen Raikow kämpft als Kommunist in Belgrad gegen den Faschismus, kritisiert dann jedoch den Hitler-Stalin-Pakt und wird von der Partei fallengelassen, als er gefangen und gefoltert wird. Zum Kriegsdienst nach Wien geschickt, bleibt er dort und versucht im Nachkriegswien als Antiquar und Schriftsteller zu überleben. Raikows lieben enthält viele Parallelen mit dem lieben des serbischen Autors, der als Milutin Doroslovac 1923 in Rudapest geboren wurde und in Belgrad aufgewachsen ist, im Kampf gegen den Faschismus verhaftet, gefoltert und zur Zwangsarbeit nach Wien geschickt wurde.
„Wie ich sehe, schreibe ich etwas, das schon allgemein bekannt ist. Was mich interessiert, ist, warum die einen immer wieder den falschen Propheten auf den Leim gehen und die anderen, die wissen, daß alles ein blutiger Humbug ist, keinen richtigen Widerstand leisten.” (60) Diese Frage scheint Dor von jeher zu interessieren und muß ihn auch, mit seinen Erfahrungen, die zu belegen scheinen, daß sich die Geschichte immer wiederholt Was ist aus all jenen geworden, fragt sich Raikow, die der Aktion Mitmensch gefolgt sind, um für einen humanen Umgang zu demonstrieren. Wo sind sie jetzt, da die ' Bewegung an der Macht ist?
Als müßte er alle seine Vermutungen und Befürchtungen relativieren, setzt Dor leider ein Schlußkapitel hinzu, in dem ein anderer Ich-Erzähler auftaucht, der sich als Freund Raikows ausgibt und feststellt, daß der Text nicht 1999, sondern 1996/97 geschrieben wurde. Und er kommentiert den Text, wie um ihn von vornherein gegen politische Anfechtungen abzusichern, dabei fällt auch das erste Mal der Name Haider: „Manche Leute könnten leicht glauben, Raikow habe darunter Jörg Haider gemeint, den Rechtsaußen unserer heimischen Politik, der sich in der letzten Zeit eines immer größeren Zulaufs aus den Kleinbürgerschichten erfreut, aber auch die Unterstützung einiger reicher, ebenso kleinkarierter Unternehmer genießt. Mladen Raikow hatte ganz bestimmt nicht ihn gemeint, sondern einen von Haiders Adepten, der se'ine oft unreflektierten und leichtfertig dahingesprochenen Riertisch-phrasen beim Wort nimmt und sie mit Hilfe seiner zahlreichen Gleichgesinnten stur durchzuführen versucht, um eine ,Dritte Republik' autoritärer Prägung zu etablieren. Wer sich von Raikows Schilderungen betroffen fühlt, fühlt sich mit Recht betroffen.” (117) Und der Ich-Erzähler fügt hinzu, er sei nicht so pessimistisch, weil er viele Leute kenne, die sich von keinen falschen Propheten irreführen lassen und in der Stunde der Gefahr auf die Straße gehen werden, um für Freiheit und Menschenrechte zu demonstrieren. Und er fügt Mutmaßungen hinzu, was wohl mit Raikow passiert sei, ob er seinen Traum von fröhlichen Menschen in einem sonnigen Land verwirklichen konnte ... und ob er Wien wirklich fernbleiben könne, weil die Haßliebe zu und damit die Sehnsucht nach Wien wohl ewig bestehen würde.
Vielleicht hätte Dor eher einen politischen Essay schreiben sollen, denn eine Geschichte, wie sie der Untertitel nennt. Denn das Buch drängt zur Mahnung, Aufklärung und Warnung und leistet Nachhilfeunterricht in Geschichte, bei dem man schier den erhobenen Zeigefinger sieht. Schade. Mehr literarische Aufarbeitung hätte dem Stoff gutgetan und ist nur stellenweise gelungen. Es hat fast den Anschein, als könnte der Autor nicht anders als mahnend schreiben, wohl weil ihm selber die Themen wie z. B. die Fremdenfeindlichkeit so nahe gehen. Sein engagiertes Schreiben mutet daher fast altmodisch an. Was aber nicht bedeutet, daß das Thema nicht aktuell wäre, sehr aktuell, und die Negativ-Utopie geradezu beängstigend. Mußte er selbst sich davor schützen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!