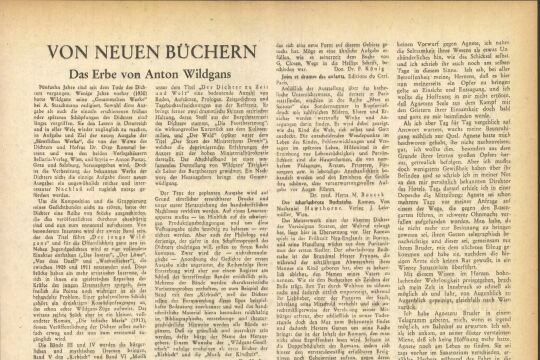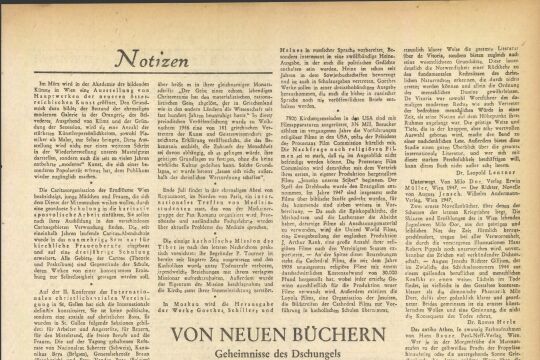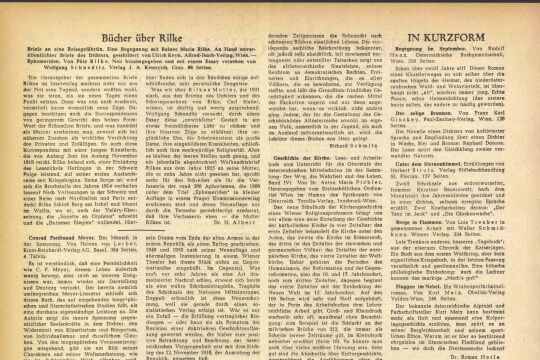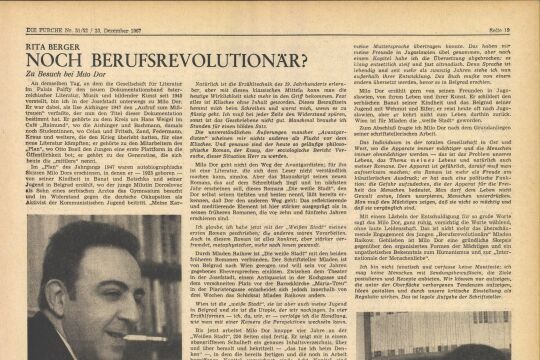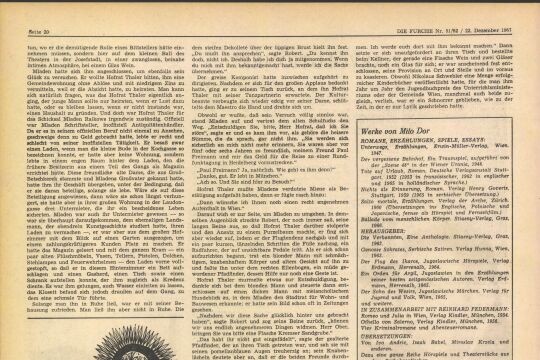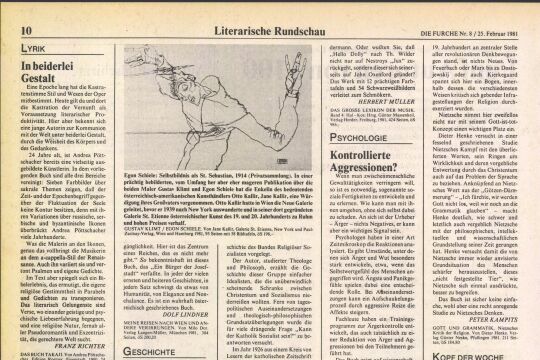Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
NOCH BERUFSREVOLUTIONÄR?
An demselben Tag, an dem die Gesellschaft für Literatur im Palais Palffy den neuen Dokumentationsband österreichischer Literatur, Musik und bildender Kunst seit 1945 vorstellt, bin ich in der Josefstadt unterwegs zu Milo Dor. Er war dabei, als Ilse Aichinger 1947 den „Aufruf zum Mißtrauen“ verfaßte, der nun den Titel dieser Dokumentation bestimmt hat. Er gehörte zu dem Kreis um Hans Weigel im Cafe „Raimund“, wo die Aichinger und Bachmann, damals noch Studentinnen, wo Celan und Fritsch, Zand, Federmann, Kraus und weitere, die den Krieg überlebt hatten, für eine neue Literatur kämpften; er gehörte zu den Mitarbeitern des „Plan“, wo Otto Basil den Jungen eine erste Plattform in die Öffentlichkeit bot; er gehört zu der Generation, die sich heute die „mittlere“ nennt.
Im „Plan“ des Jahrgangs 1947 waren autobiographische Skizzen Milo Dors erschienen, in denen er — 1923 geboren — von seiner Kindheit in Banat und Batschka und seiner Jugend in Belgrad erzählt, wo der junge Milutin Doroslovac als Sohn eines serbischen Arztes das Gymnasium besucht und im Widerstand gegen die deutsche Okkupation als Aktivist der Kommunistischen Jugend beitritt. „Meine Kar-
riere als Berufsrevolutionär wurde im März 1942 jäh beendet, als die Belgrader Spezialpolizei, die der Gestapo unterstand, mich auf der Straße verhaftete.“
Nach Monaten im Gestapogefängnis und Jugendlager wird der unbequeme Student als Fremdarbeiter nach Wien verschickt, erlebt da 1945 den Einmarsch der Russen und das Kriegsende. Der junge Serbe kehrt nicht nach Jugoslawien zurück, erwirbt die österreichische Staatsbürgerschaft und wird Schriftsteller, wird Milo Dor, dessen Roman „Tote auf Urlaub“ zu den bedeutendsten literarischen Zeugnissen der Kriegszeit zählt und von Hans Weigel als Roman der „heimatlosen Linken Mitteleuropas“ bezeichnet wurde.
Ist Milo Dor noch der Mladen Raikow seines autobiographischen Romans, finde ich in ihm noch eine Spur des „Berufsrevolutionärs“?
★
Die Hausglocke in der Pfeilgasse warnt nicht schrill vor einem Eindringling, sondern meldet in freundlichem Doppelklang den Gast. Gastlich, hell, warm nehmen ihn die Zimmer auf, die wir auf dem Weg zu Milo Dors Arbeitsraum durchqueren; Wohnkultur, wie man sie in Wien trifft: Biedermeiermöbel, ein Aquarell von Gütersloh und ein Gobelin nach seinem Entwurf, zwei Bilder von Hutter, die Bücherwand mit einer Bibliothek moderner Literatur, der Pfeifenhalter über dem Schreibtisch und der Sliwowitz direkt aus Jugoslawien — da müssen die Gedanken an Mladen Raikow im Gestapogefängnis, an die „Toten auf Urlaub“ und an das Wien der ersten Nachkriegszeit gewaltsam zurückgeholt werden.
Doch es stimmt, ich bin Mladen Raikow. Diese Gestalt, der ganze Roman, ist von meinen persönlichen Erlebnissen getragen. Alle meine ersten Arbeiten nach dem Krieg haben starke autobiographische Züge ebenso wie Bolls „Wo bist du, Adam?“ oder Grass' „Blechtrommel“. Das war eine allgemeine Erscheinung.
Heute sind zwanzig Jahre seit dieser Zeit vergangen. Milo Dor gilt als erfolgreicher Autor beliebter Kriminalromane, Rundfunkfeatures, in manche Sprachen übersetzter Hörspiele und unterhaltsamer Fernsehspiele, die keineswegs mehr vom Kriegserleben bestimmt sind.
Das wird halt gut bezahlt, und ich muß schließlich eine Familie ernähren; mein Sohn studiert an der Hochschule für Film und Fernsehen.
Zuerst habe ich, um Geld zu verdienen, mit Reinhard Federmann zusammen Kriminalromane fabriziert. Fünf in zwei Jahren. Die „Internationale Zone“ zum Beispiel ist damals beim gemeinsamen Spintisieren an einem Kaffeehaustisch im Eisenbahnerheim in Margareten entstanden. In einigen Tagen, mit der Hand geschrieben. ■ Heute sind Übersetzungen, Funk- und TV-Arbeiten sozusagen mein Brotberuf, meine tägliche Arbeit. Aber Günter Grass hatte ganz recht, als er sagte: „Wenn ich mit Bleistift und einem Stück Papier auf eine Insel verschlagen würde, würde ich im Traum nicht daran denken, ein Hörspiel zu schreiben!“ Wie gesagt: Es ist mein Brotberuf. Aber ich bin Romancier und tue nichts lieber als Romane schreiben, auch wenn man vom Romanschreiben, das ich nachts und mit sehr viel Zigaretten und Kaffee besorge, nicht leben kann.
Unser Gespräch dreht sich lange um die Situation des modernen Romans. Und die Lebhaftigkeit, mit der Milo Dor dieses Thema immer wieder von allen Seiten abtastet, verrät, daß damit das Existenzproblem des Romanciers berührt ist, mit dem er sich auch in der Theorie auseinandersetzen muß.
Natürlich ist die Erzähltechnik des 19. Jahrhunderts erlernbar, aber mit diesen klassischen Mitteln kann man die heutige Wirklichkeit nicht mehr in den Griff bekommen. Fast alles ist Klischee ohne Inhalt geworden. Dieses Bewußtsein hemmt mich beim Schreiben und warnt mich, wenn es zu flüssig geht. Ich muß bei jeder Zeile den Widerstand spüren, sonst ist das Geschriebene nicht gut. Manchmal brauche ich Stunden für einen blöden Satz.
Die unverständlichen Äußerungen mancher „Avantgardisten“ scheinen mir nichts anderes als Flucht vor dem Klischee. Und genauso sind der heute so geläufige philosophische Roman, der Essay, der soziologische Bericht Versuche, dieser Situation Herr zu werden.
Milo Dor geht nicht den Weg der Avantgardisten; für ihn ist eine Literatur, die sich dem Leser nicht verständlich machen kann, sinnlos. Aber das Manuskript seines neuen Romans, das auf dem Schreibtisch liegt und im nächsten Jahr erscheinen soll, dieses Romans „Die weiße Stadt“, den Dor selbst seinen tiefsten und besten nennt, läßt bereits erkennen, daß Dor den anderen Weg geht: Das reflektierende und meditierende Element ist hier stärker ausgeprägt als in seinen früheren Romanen, die vor zehn und fünfzehn Jahren erschienen sind.
Ich glaube, ich habe jetzt mit der „Weißen Stadt“ meinen ersten Roman geschrieben; die anderen waren Vorarbeiten. Auch in diesem Roman ist alles konkret, aber stärker verfremdet, metaphysischer, mehr nach innen gewandt.
Durch Mladen Raikow ist „Die weiße Stadt“ mit den beiden früheren Romanen verbunden. Der Schriftsteller Mladen ist von Belgrad nach Wien gezogen und will sein vor Jahren gegebenes Eheversprechen einlösen. Zwischen dem Theater in der Josefstadt, einem Antiquariat in der Kochgasse und dem verschneiten Platz vor der Barockkirche „Maria-Treu“ in der Piaristengasse entscheidet sich jedoch innerhalb von drei Wochen das Schicksal Mladen Radkows anders.
Wien ist die „weiße Stadt“, sie ist aber auch meine Jugend in Belgrad und sie ist die Utopie, der wir nachjagen. In vier Erzählformen — ich, du, wir, er — verfolge ich die Handluna. wie man mit einer Kamera die Perspektiven wechseln kann.
Bis jetzt arbeitet Milo Dor knappe vier Jahre an der „Weißen Stadt“, 250 Seiten sind fertig. Er zeigt mir in einem abgegriffenen Schulheft ein genaues Inhaltsverzeichnis, über und über bemalt und bekritzelt — „das tue ich beim Denken“ —, in dem die bereits fertigen und die noch in Arbeit begriffenen Kapitel verzeichnet sind: Acht Kapitel sind komplett fertig, sechs erst in den Anfängen. Das Inhaltsverzeichnis nennt er die Architektur, das Gerüst, an dem nicht mehr gerüttelt wird.
Die einzelnen Kapitel haben dann noch Bewegungsfreiheit; obwohl ihr Schicksal sicher ist, haben sie Verteidigungsmöglichkeit. Ich schreibe die erste Fassung mit der Hand in einfache Schulhefte; die erste Korrektur besorge ich bei der Übertragung der Handschrift in die Schreibmaschine; die Maschinßnfassung wird wieder überarbeitet und dann noch einmal abgetippt.
Zur Arbeit am Roman brauche ich die Ruhe, Abgeschlossenheit und Ausgeglichenheit der Nacht. Wenn ich dann noch nicht recht ins Schreiben komme, übersetze oder lese ich zur sprachlichen Einübung Gedichte oder nehme zur Abwechslung einen Kriminalroman. Ich bin nämlich leidenschaftlicher Krimileser und ebenso begeisterter Westernfan.
Das Telephon unterbricht uns. „ ... Gut, danke ... Vojno groblje heißt Militärfriedhof... ja, gibt es in Pula ...“
„Das war Eisenreich“, erklärt Milo Dor, „er schreibt etwas über Istrien und wollte eine genaue Übersetzung.“
Milo Dor wird oft von seinen Kollegen zu Hilfe gerufen, wenn es um slawische Sprachen geht. Und ein leichter Akzent verrät auch jetzt noch nach mehr als zwanzig Jahren Aufenthalts in Wien, daß Milo Dors Muttersprache nicht Deutsch ist.
Damit hatte ich in den ersten Jahren als Schriftsteller natürlich meine Schwierigkeiten. Otto Basil mußte zum Beispiel mein Manuskript von „Unterwegs“ 1947 zuerst korrigieren und m ein gutes Deutsch bringen, bevor es zum Verlag ging. Heute schreibe ich natürlich mühelos ein fehlerfreies Deutsch, es ist mir vertrauter als Serbokroatisch. Das geht so weit, daß ich „Nichts als Erinnerung“ nicht mehr selbst in
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!