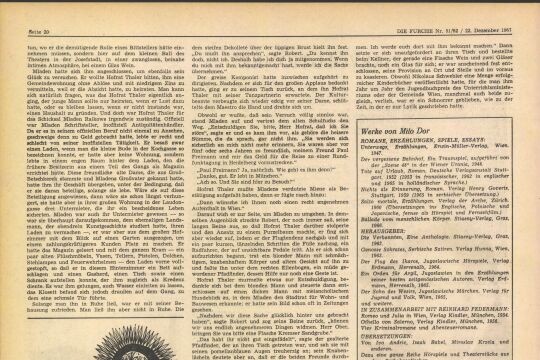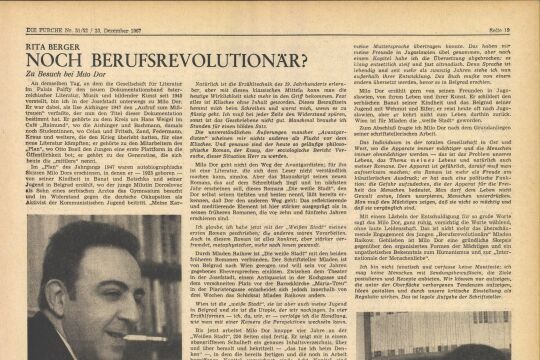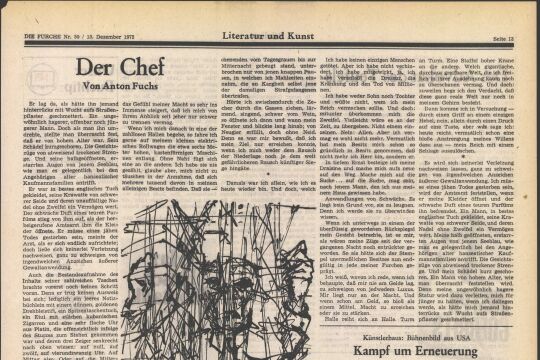Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DIE ROLLEN
Als der greise Komponist mit jugendlichem Schwung einen seiner bewährten Walzer zu dirigieren begann, wußte Mladen Raikow, daß seine Sache endgültig verloren war.
Hofrat Thaler, der Mann, dessentwegen er auf diesen Ball gekommen war, stand auf, verbeugte sich eckig vor der Frau des Komponisten, einer schwarzäugigen, etwas üppigen, aber noch jung wirkenden Schönheit, führte sie zur Tanzfläche und fing dort an, sich mit ihr zu drehen, steif, auf den Fußballen hüpfend und mit einem konzentrierten, beinahe verbissenen Gesichtsausdruck; offenbar nahm er seine Rolle als Kavalier sehr ernst. Er war kleiner als die Frau des berühmten Komponisten, so daß seine Nase in ihrem leicht vorspringenden Dekollete steckenzubleiben drohte, wenn er sich bei einer scharfen Drehung für kurze Zeit auf den ganzen Fußsohlen niederließ, um das verflogene Gleichgewicht wieder zu erlangen. Der alte Schulfuchs, der im Kulturrat der Gemeinde Wien eine wichtige, wenn nicht die entscheidende Rolle spielte, entledigte sich jedoch seiner Aufgabe mit einer gewissen Würde, die nicht einmal durch den viel zu engen Smoking, den er trug, beeinträchtigt wurde
„Hat er seinen Smoking noch seit seiner Promotionsfeier?“ fragte sich Mladen laut.
„Er ist kein Doktor“, sagte Mladens Freund Robert, der neben ihm saß.
„Na schön, dann muß er ihn schon seit der Matura oder seit der Abschlußprüfung im Lehrerseminar haben. Oder hat er ihn von einer Kostümleihanstalt bekommen, so wie ich den meinen? Wäre das der Fall, dann hätten wir wenigstens ein gemeinsames Gesprächsthema, als Einführung sozusagen.
meine Muttersprache übertragen konnte. Das haben mir meine Freunde in Jugoslawien übel genommen, aber nach einem Kapitel habe ich die Übersetzung abgebrochen: es klang entsetzlich steif und fast altmodisch. Denn Sprache ist lebendig und seit mehr als zwanzig Jahren stehe ich nun außerhalb ihrer Entwicklung. Das Buch mußte von einem andern übersetzt werden, bevor es in Belgrad erschien.
Milo Dor erzählt gern von seinen Freunden in Jugoslawien, von ihrem Leben und ihrer Kunst. Er schildert den serbischen Banat seiner Kindheit und das Belgrad seiner Jugend mit Wehmut und Eifer; er reist heute oft nach Jugoslawien, aber er kehrt nicht zum Leben dorthin zurück. Wien ist für Mladen die „weiße Stadt“ geworden.
Zum Abschluß fragte ich Milo Dor nach dem Grundanliegen seiner schriftstellerischen Arbeit.
Das Individuum in der totalen Gesellschaft in Ost und West, wo die Apparate immer mächtiger und die Menschen immer ohnmächtiger werden — das ist das Problem unseres Lebens, das Thema meines Lebens und natürlich auch meiner Romane. Der Apparat ist gefährlich, darauf muß man aufmerksam machen; ein Roman ist mehr als Freude am künstlerischen Ausdruck; er hat auch eine politische Funktion: die Gefahr aufzudecken, die der Apparat für die Freiheit des Menschen bedeutet. Man darf dem Leben nicht Gewalt antun, Ideen usurpieren, Menschen unterdrücken. Man muß den Mächtigen zeigen, daß sie nicht so mächtig und daß sie vergänglich sind.
Mit einem Lächeln der Entschuldigung für so große Worte sagt das Milo Dor, ganz ruhig, vorsichtig die Worte wählend, ohne laute Leidenschaft. Das ist nicht mehr das überschäumende Engagement des jungen „Berufsrevolutionärs“ Mladen Raikow. Geblieben ist Milo Dor eine gründliche Skepsis gegenüber den organisierten Formen der Mächtigen und ein unpathetisches Bekenntnis zum Humanismus und zur „Internationale der Menschenliebe“.
Ich bin nicht fanatisch und verfasse keine Manifeste; ich mag keine Menschen mit Sendungsbewußtsein, die Ziele postulieren und Rezepte anbieten. Wir können nur aufzeigen, die unter der Oberfläche verborgenen Tendenzen aufzeigen, Ideen gestalten und durch unsere kritische Einstellung als Regulativ wirken. Das ist legale Aufgabe der Schriftsteller.
Warum findet man nie ein passendes Kleidungsstück in den Leihanstalten? Sein Smoking ist zu klein und meiner zu groß. Vielleicht sollten wir sie tauschen oder wenigstens vereinbaren, daß wir das nächste Mal zusammen hingehen.“
„Er ist doch kleiner als du. Sein Smoking würde dich noch mehr beengen als ihn. Außerdem muß er doch einen eigenen Smoking haben. Er geht oft zu solchen Veranstaltungen.“
Auch Robert hatte einen eigenen Smoking, einen mitternachtsblauen, mit weinroter Schärpe. Außer diesem prachtvollen Kleidungsstück besaß er aber nicht viel. Er hatte nicht einmal eine Wohnung oder ein Atelier, wie es sich für einen Maler gehörte. Die Wohnung hatte er seiner Frau überlassen, einer nicht sehr begabten Modezeichnerin, die ihn in Zusammenarbeit mit ihren zahlreichen Freunden und Freundinnen buchstäblich hinausgebissen hatte. Jetzt hatte er eine Schlafstelle und zugleich eine Arbeitsecke im Atelier eines Freundes, der in diesem provisorisch adaptierten Teil des Dachbodens mit seiner Frau und seinen zwei Kindern hauste. Als Robert in seiner Verzweiflung zum Kulturamt der Gemeinde Wien gegangen war, hatte man ihm eine ehemalige Schusterwerkstätte auf dem Wallensteinplatz zugewiesen. Der kleine Laden, den man über drei Treppen von der Straße aus betreten konnte, hatte keine Nebenräume — die Wasserleitung und das Klosett waren im Gang dahinter — und befand sich in einem so desolaten Zustand — die Wände waren feucht und der alte Bretterboden morsch — daß er für seine Sanierung und Adaptierung hätte fast mehr ausgeben müssen als für eine kleine Eigentumswohnung. Nun wollte er sich bei Hofrat Thaler darüber beschweren und ihn um Intervention ersuchen; er wollte es nicht in einem Büro
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!