Das Theater an der Wien zeigt eine musikalisch brillante, auch szenisch durchaus überzeugende Produktion von Debussys "Pelléas et Mélisande". So spannend, so aufregend, mit so viel Finesse modelliert, hat man dieses notorisch unterschätzte Werk in Wien noch kaum je gehört.
Bertrand de Billy scheint ein Glückspilz: Was er anpackt, wird zum Erfolg. Sei es, dass er seinen Nachfolger als Chef des RSO Wien durchsetzt (s. u.) oder gleich bei einer Premiere deutlich macht, wie falsch Urteile sind, auch wenn sie jahrzehntelange Tradition haben. Wer nach diesem Premierenabend noch behauptet, Debussys "Pelléas et Mélisande" sei langweilig, dem ist nicht zu helfen. Unglaublich, was de Billy an Farben und Stimmungen aus der Partitur herausholt, zu welchem differenzierten Spiel er seine ORF-Symphoniker anleitet, mit welchem Feinsinn er die Protagonisten begleitet, wie er auf ihre Ansprüche reagiert. Selbst wenn man die letzte Wiener Produktion - und das war eine der vorzüglichen der Ära Drese - noch im Ohr hat: So spannend, so aufregend, mit so viel Finesse modelliert, hat man diesen Debussy in Wien kaum je gehört.
Was, wenn auch mit einigen Abstrichen, auch an den übrigen Protagonisten liegt. Gewiss, über Chantal Thomas' Bühnenbild - im Wesentlichen ein düsterer Wald, aus dem sich zuweilen das gleich düstere Innere eines Schlosses schält - lässt sich verschiedener Meinung sein. Weil man diese Quasi-"Nachtlandschaft" architektonisch weitaus subtiler gestalten, mehr mit punktgenauen Lichteffekten (Licht: Joel Adam) hätte arbeiten können. So aber lenkt dieses Ambiente kaum vom Wesentlichsten ab: dem immer wieder zu dramatischen Wendungen führenden Beziehungsdrama.
Liebe, Eifersucht, aber auch Gewalt, verdeckte wie offene - das sind die beherrschenden Themen dieses Librettos, in dem oft zwischen Traum und Wirklichkeit nicht entschieden wird. Regisseur Laurent Pelly - er zeichnet zudem für die von der Entstehungszeit des Stücks inspirierten Kostüme verantwortlich - macht erst gar nicht den Versuch, mit einer Deutung aufzuwarten. Stattdessen konzentriert er sich, und dies konsequent den Abend über, auf das Beziehungsgeflecht der einzelnen Protagonisten, denen er von Beginn weg ein klar umrissenes Profil gibt, das ihre individuelle Persönlichkeit betont.
Liebreizende Fragilität
Die vokal untadelige, exemplarisch stimmdeutliche Mélisande von Natalie Dessay changiert zwischen liebreizender Fragilität und sensibel lichtdurchfluteter Freude; der offensichtlich am Beginn einer großen Karriere stehende Stéphane Degout als Pelléas punktet mit differenzierter Artikulation und aristokratischer Noblesse. Vom ersten Augenblick an nimmt man Golauds innere Zerrissenheit und die ihn bis zum Mord treibende Eifersucht wahr, so authentisch agiert der schließlich mit profunder Tiefe aufwartende Laurent Naouri. Eine durch nichts aus der Ruhe zu bringende Altersweisheit dokumentiert sich im Spiel des ebenso selbstverständlich mit seiner Rolle verwachsenen Phillip Ens als Arkel. Tim Mirfin (er mimt auch den Hirten) nimmt man die Figur des Arztes derart ab, dass man beinahe erstaunt ist zu lesen, dass er nicht Medizin, sondern neben Musik ein Jusstudium absolviert hat.
Der Dirigent hat recht behalten
Marie-Nicole Lemieux lässt in der Rolle von Geneviève, der Mutter der durch Eifersucht auseinandergetriebenen Brüder Pélleas und Golaud, allerdings einige Wünsche in puncto vokale Sicherheit, Souveränität in der Höhe, aber auch Bühnenpräsenz offen. Und Beate Ritter demonstriert bei ihrer gestalterisch weit mehr beeindruckenden Deutung des Yniold, Golauds Sohn aus der Ehe mit seiner verstorbenen Frau, zu deutlich, mit welchen Schwierigkeiten Debussy diese gewiss nicht sehr dankbare Partie ausgestattet hat. Dafür lässt der Arnold Schoenberg Chor, wenngleich er diesmal nur wenig zu tun hatte, keinen Zweifel über seine spezifischen Qualitäten.
Wie sagte doch Bertrand de Billy im Vorfeld: "Es ist absolut möglich, diese Oper populär zu machen - im guten Sinn von populär -, wenn die Darsteller auf der Bühne wieder singen und spielen können." Vorausgesetzt, der Dirigent legt die entsprechende Basis. Ganz wie es de Billy vorzeigt. Alleine deshalb muss man diesen "Pelléas" gesehen haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

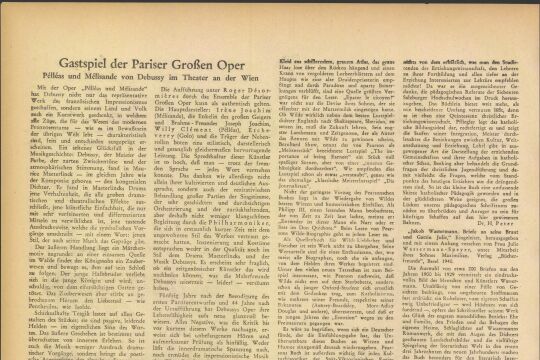
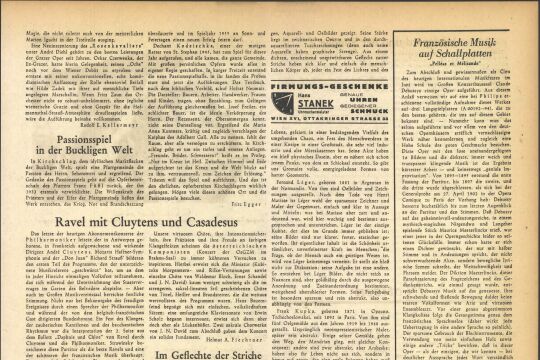






































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)





