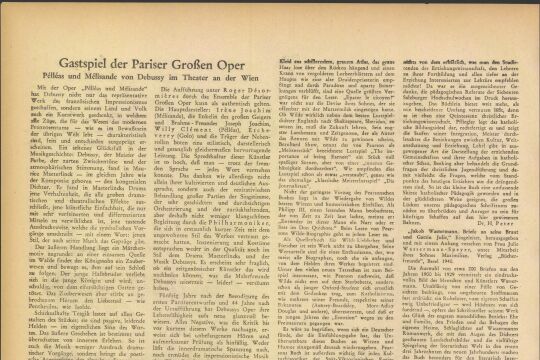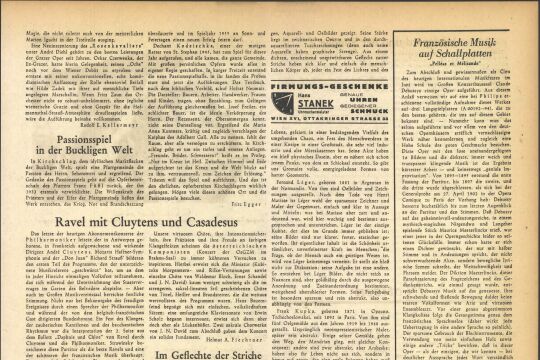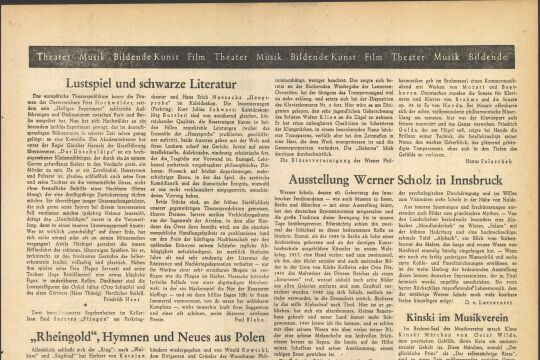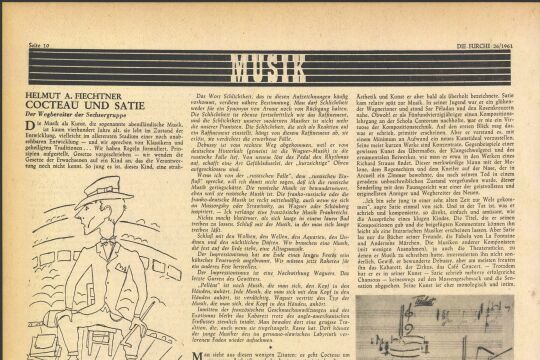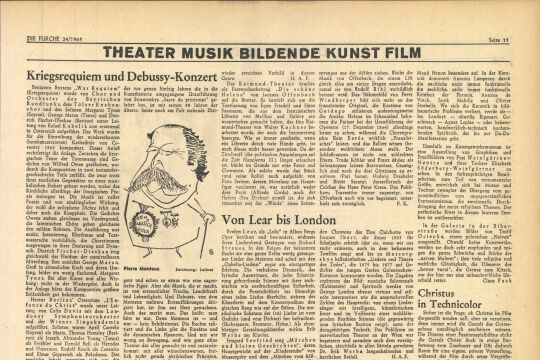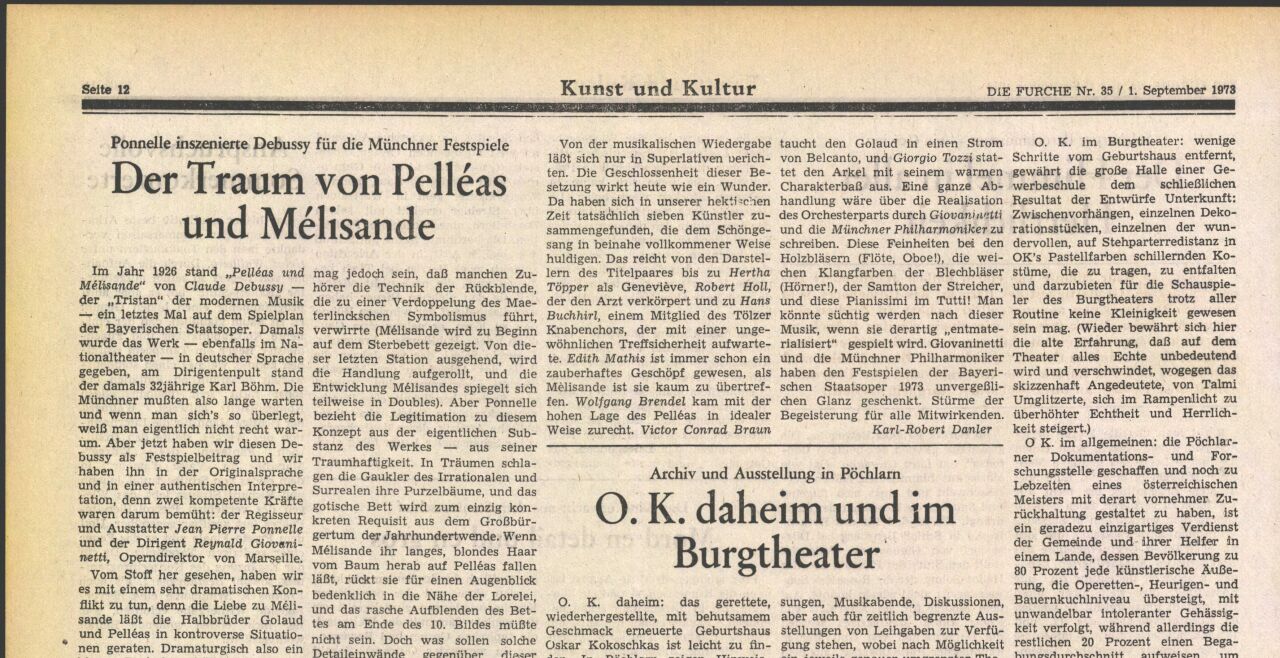
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Traum von Pelleas und Mélisande
Im Jahr 1926 stand „Pelleas und Melisande“ von Claude Debussy — der „Tristan“ der modernen Musik — ein letztes Mal auf dem Spielplan der Bayerischen Staatsoper. Damals wurde das Werk — ebenfalls im Nationaltheater — in deutscher Sprache gegeben, am Dirigentenpult stand der damals 32jährige Karl Böhm. Die Münchner mußten also lange warten und wenn man sich's so überlegt, weiß man eigentlich nicht recht warum. Aber jetzt haben wir diesen Debussy als Festspielbeitrag und wir haben ihn in der Originalsprache und in einer authentischen Interpretation, denn zwei kompetente Kräfte waren darum bemüht: der Regisseur und Ausstatter Jean Pierre Ponnelle und der Dirigent Reynald Giovani-netti, Operndirektor von Marseille.
Vom Stoff her gesehen, haben wir es mit einem sehr dramatischen Konflikt zu tun, denn die Liebe zu Melisande läßt die Halbbrüder Golaud und Pelleas in kontroverse Situationen geraten. Dramaturgisch also ein klares Dreiecksverhältnis. Doch bei Maeterlinck/Debussy wird alles symbolisch überhöht und in eine traumhafte Poesie entrückt. Es ist viel Geheimnisvolles, Unwirkliches um diese Gestalten, und Debussy schuf eine Partitur von geradezu hypochondrischer Sensibilität. Es ist also außerordentlich schwer, dieses Werk in den Griff zu bekommen, nicht nur die Traumwelt glaubhaft zu machen, sondern auch diese Ideenwelt darzustellen, zu realisieren, dann durchzuhalten und keinen Stilbruch aufkommen zu lassen. Das fordert auch dem Zuschauer Konzentration ab (das Publikum der Premiere war so gebannt, daß man den Eindruck hatte, Ponnelle habe es hypnotisiert). Es mag jedoch sein, daß manchen Zuhörer die Technik der Rückblende, die zu einer Verdoppelung des Mae-terlinckschen Symbolismus führt, verwirrte (Melisande wird zu Beginn auf dem Sterbebett gezeigt. Von dieser letzten Station ausgehend, wird die Handlung aufgerollt, und die Entwicklung Melisandes spiegelt sich teilweise in Doubles). Aber Ponnelle bezieht die Legitimation zu diesem Konzept aus der eigentlichen Substanz des Werkes — aus seiner Traumhaftigkeit. In Träumen schlagen die Gaukler des Irrationalen und Surrealen ihre Purzelbäume, und das gotische Bett wird zum einzig konkreten Requisit aus dem Großbürgertum der Jahrhundertwende. Wenn Melisande ihr langes, blondes Haar vom Baum herab auf Pelleas fallen läßt, rückt sie für einen Augenblick bedenklich in die Nähe der Lorelei, und das rasche Aufblenden des Bettes am Ende des 10. Bildes müßte nicht sein. Doch was sollen solche Detaileinwände gegenüber dieser phänomenalen Leistung Ponmlles, welche die immer nur schwebenden, hinter einem Schleier der Andeutung verharrenden Aktionen atmosphärisch so zu verdichten versteht, daß die Spannung nicht einen Atemzug lang abbricht. Das ist nur möglich, weil Ponnelle ganz aus der Musik heraus gestaltet und zu einer nahtlosen Verbindung von Personenregie und Ausstattung findet. Seit dem Wiederaufbau des Nationaltheaters hatte man noch keine derartig subtile und differenzierte Lichtregie in diesem Haus erlebt, und noch nie wurde die Drehbühne als Handlungselement so überzeugend integriert.
Von der musikalischen Wiedergabe läßt sich nur in Superlativen uerich-ten. Die Geschlossenheit dieser Besetzung wirkt heute wie ein Wunder. Da haben sich in unserer hektischen Zeit tatsächlich sieben Künstler zusammengefunden, die dem Schöngesang in beinahe vollkommener Weise huldigen. Das reicht von den Darstellern des Titelpaares bis zu Hertha Töpper als Genevieve, Robert Holl, der den Arzt verkörpert und zu Hans Buchhirl, einem Mitglied des Tölzer
Knabenchors, der mit einer ungewöhnlichen Treffsicherheit aufwartete. Edith Mathis ist immer schon ein zauberhaftes Geschöpf gewesen, als Melisande ist sie kaum zu übertreffen. Wolfgang Brendel kam mit der hohen Lage des Pelleas in idealer Weise zurecht. Victor Conrad Braun taucht den Golaud in einen Strom von Belcanto, und Giorgio Tozzi stattet den Arkel mit seinem warmen Charakterbaß aus. Eine ganze Abhandlung wäre über die Realisation des Orchesterparts durch Giovani uitti und die Münchner Philharmoniker zu schreiben. Diese Feinheiten bei den Holzbläsern (Flöte, Oboe!), die weichen Klangfarben der Blechbläser (Hörner!), der Samtton der Streicher, und diese Pianissimi im Tutti! Man könnte süchtig werden nach dieser Musik, wenn sie derartig „entmaterialisiert“ gespielt wird. Giovaninetti und die Münchner Philharmoniker haben den Festspielen der Bayerischen Staatsoper 1973 unvergeßlichen Glanz geschenkt. Stürme der Begeisterung für alle Mitwirkenden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!