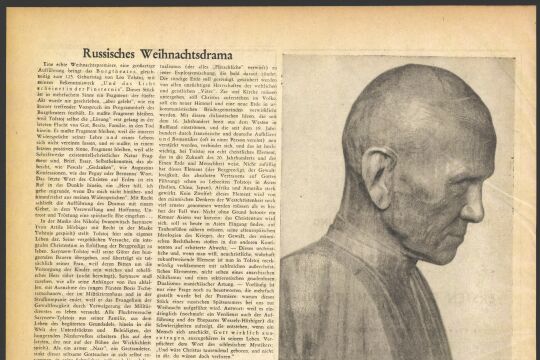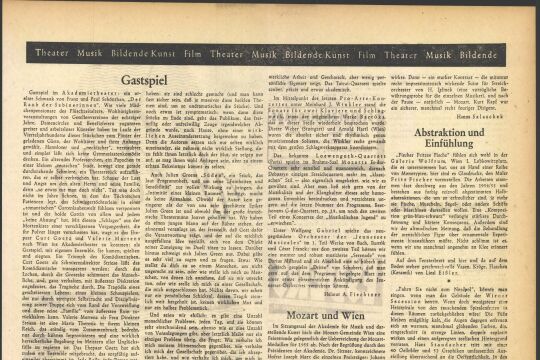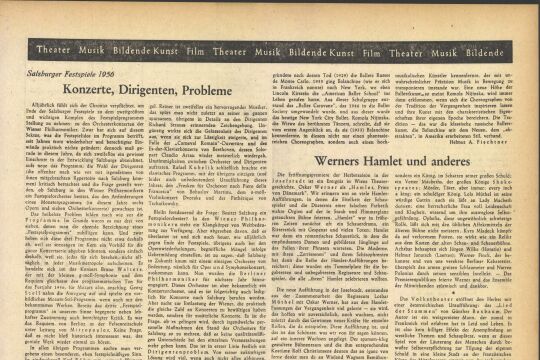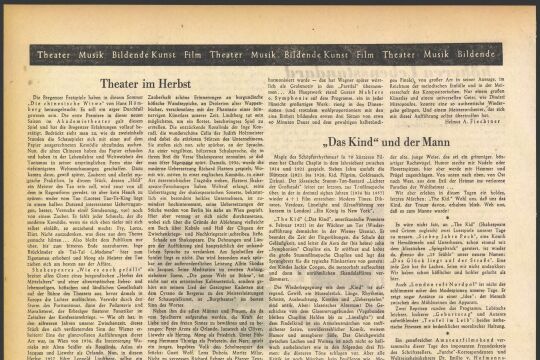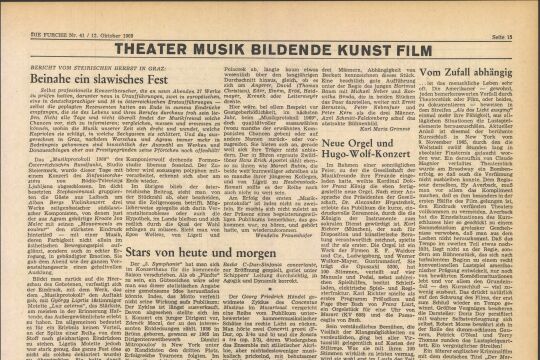Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ballett im Konzert: Bergers „Jahreszeiten“
Der Wiener Komponist Theodor B e r g e r, Jahrgang 1905 und österreichischer Staatspreisträger von 1960, eine der profiliertesten schöpferischen Begabungen unserer Stadt, stellt — und beantwortet — mit seinem letzten Werk, das im 2. Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker unter Dimitri Mitropoulos uraufgeführt wurde, die Frage, ob heute noch „Programmusik“ möglich ist. Sein knapp 30 Minuten dauerndes Stück mit dem Titel „Jahreszeiten“ ist zwar als Ballettmusik für die Wiener Staatsoper konzipiert (wo es noch im Laufe dieser Spielzeit gegeben wird), erhebt aber afigleich — mit dem Untertitel „Symphonie in vier Sätzen“ — Anspruch, auch als absolute Musik gewertet zu werden. Zunächst zum Programm. Hierüber sagt Berger: „Vielleicht empfiehlt der poetische Takt, im Programmheft nur die knappen Titel aufzuzeigen. Demgegenüber zeigt wieder die Erfahrung, daß es viele Konzertbesucher gibt, die bei den erweiterten Titeln besser genießen können.“ Aber bereits die „knappen“ Titel geben programmatische Anregung genug. Jeder der vier Sätze ist einer Jahreszeit zugeordnet, und der erste Teil ist beispielsweise folgendermaßen gegliedert: Herbstsonne — Reife — Ernte — Vogelzug — Scheiden — Entsagen — Einsamkeit, im „Winter“-Satz gibt es einen Schneesturm, unter der
Frühlingssonne einen „Corso“, und der abschließende „Sommer“-Satz mündet in einen Hymnus, der vom Komponisten auch als „Spätsommerlicher Glückstanz“ charakterisiert wird. Seit den frühen „Werkstattrhythmen“, der „Cronique symphonique“ und der Streicherphantasie „Malinconia“ bis herauf zur „Sin-fonia parabolica“ hat Theodor Berger, ein Einzelgänger zwischen den Schulen und Richtungen, nicht nur seine Vorliebe fürs „Programmatische“, Symphonisch-Poetische erwiesen, sondern — und das ist das viel Wichtigere — auch eine unverwechselbar persönliche Tonsprache entwickelt. Sie basiert vor allem auf (selbstkonstruierten) achtstufigen Skalen, einer eigentümlichen. Schwermütigen Melodik, dem meist chorischen Einsatz der einzelnen Instrumentalgruppen und einer raffinierten Behandlung des Schlagwerks. Mit der österreichischen Musiktradition, speziell der • Wiener Klassik, hat Berger ebensowenig zu tun wie mit der neuen „Wiener Schule“. Viele seiner Musikstücke haben vielmehr fernöstlichen Charakter, vor allem infolge ihrer „Statik“. — Hier, in seinem letzten Werk, scheint Theodor Berger einen bedeutenden Schritt vorwärts getan zu haben: Die Kürze der einzelnen Sätze und Teile impliziert viel Abwechslung: im Melodischen, im Rhythmischen und Dynamischen. In einer gewissen Monotonie lag eine Gefahr für Berger, die mit diesem letzten, äußerst erfindungs-und kontrastreichen Werk überwunden sein dürfte. Der gestische Charakter der einzelnen Episoden wird freilich erst bei einer szenischen Darbietung (als Ballett) voll zur Geltung kommen. Für eine hervorragende Aufführung haben wir den Wiener Philharmonikern und Dimitri Mitropoulos zu danken, der — bewunderungswürdig in seinem Alterl — dieses absolut neue und neuartige, technisch schwierige und in seiner Anlage kapriziöse Werk auswendig (und mit souveräner Sicherheit) dirigierte. — Dimitri Mitropoulos gehört auch zu den wehigen Dirigenten, in deren Händen man die das Konzert beschließenden symphonischen Skizzen „La me r“ von Claude D e b u s s y gut aufgehoben weiß. Hier gelangen ihm und dem virtuosen Orchester wahre Klangzauberspiele, die sich, bei genauer Betrachtung (das heißt bei kritischem Hinhören) als Resultat akkuratester Detailarbeit erweisen. Wir haben, seit jener unvergeßlichen Aufführung von Debussys größtem Orchesterwerk unter Toscanini zu Beginn der dreißiger Jahre im gleichen Saal, „La mer“ kaum mehr so schön und vollkommen gehört wie am letzten Sonntag. (Im ersten Teil des Programms stand Robert Schumanns II. — eigentlich III. — Symphonie in C-dur.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!