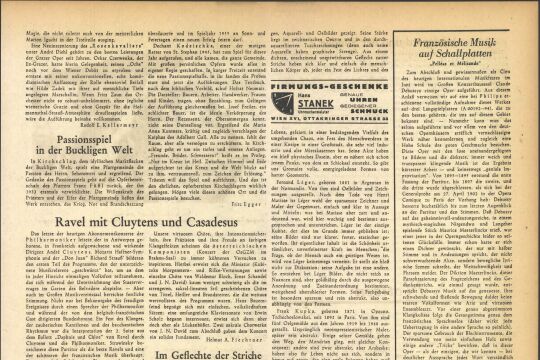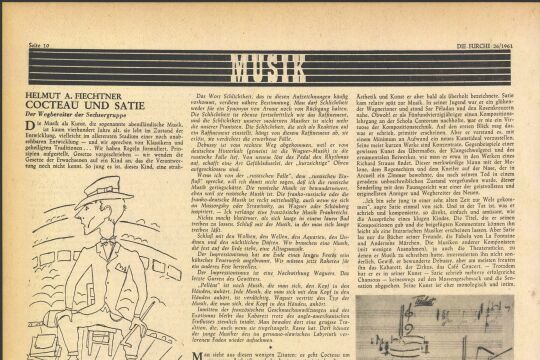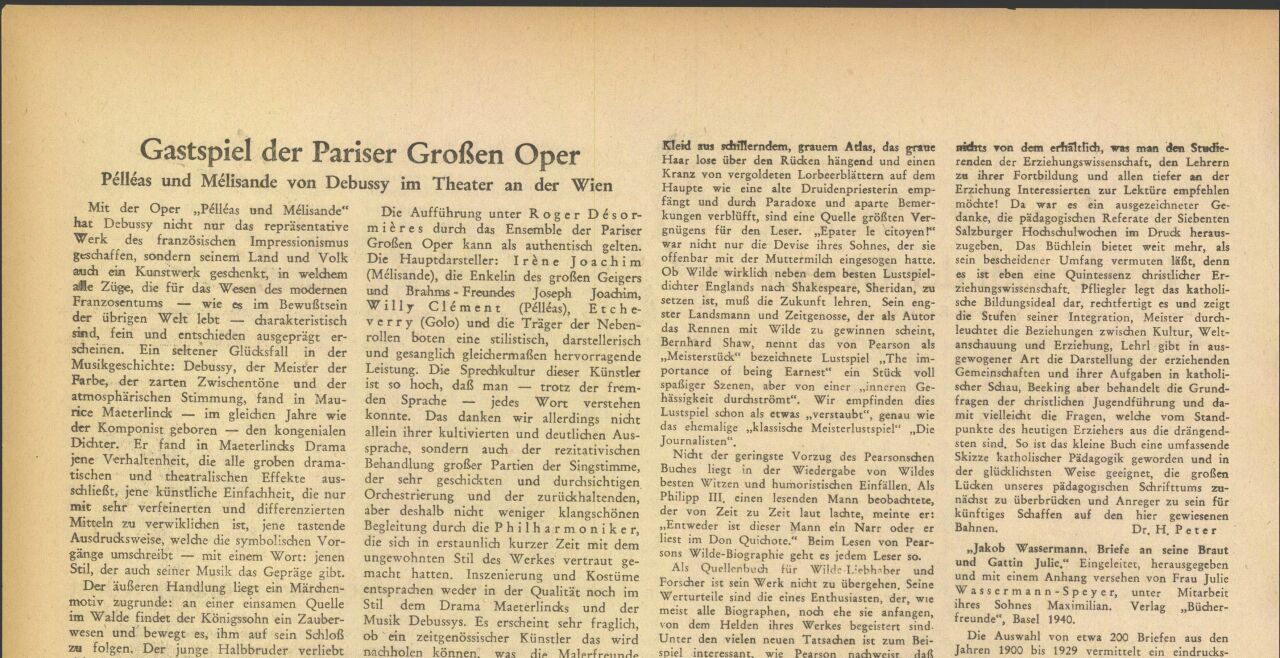
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gastspiel der Pariser Groben Oper
Mit der Oper „Pelleas und Melisande“ hat Debussy nicht nur das repräsentative Werk des französischen Impressionismus geschaffen, sondern seinem Land und Volk auch ein Kunstwerk geschenkt, in welchem alle Züge, die für das Wesen des modernen Franzosentums — wie es im Bewußtsein der übrigen Welt lebt — charakteristisch sind, fein und entschieden ausgeprägt erscheinen. Ein seltener Glücksfall in der Musikgeschichte: Debussy, der Meister der Farbe, der zarten Zwischentöne und der atmosphärischen Stimmung, fand in Maurice Maeterlinck — im gleichen Jahre wie der Komponist geboren — den kongenialen Dichter. Er fand in Maeterlincks Drama jene Verhaltenheit, die alle groben dramatischen und theatralischen Effekte ausschließt, jene künstliche Einfachheit, die nur mit sehr verfeinerten und differenzierten Mitteln zu verwiklichen ist, jene tastende Ausdrucksweise, welche die symbolischen Vorgänge umschreibt — mit einem Wort: jenen Stil, der auch seiner Musik das Gepräge gibt.
Der äußeren Handlung liegt ein Märchenmotiv zugrunde: an einer einsamen Quelle im Walde findet der Königssohn ein Zauberwesen und bewegt es, ihm auf sein Schloß z folgen. Der junge Halbbruder verliebt sich in die junge Königin und wird, unschuldig, von dem eifersüchtigen Gatten getötet. Das Zauberwesen aber stirbt an gebrochenem Herzen den Liebestod — wie Penthesilea, wie Isolde.
Schicksalhafte Tragik lastet auf allen Gestalten des Stückes; sie sind passive, leidende Helden — im eigentlichen Sinn des Wortes. Das äußere Geschehen ist bestimmt und übersdiattet von innerem Erleben. So ist auch die Musik weniger Ausdruck dramatischer Vorgänge, sondern bringt die poetische Atmosphäre der einzelnen Szenen zum Tönen. Dieser Einheitlichkeit der Gesamtstimmung entspricht auch die der musikalischen Ausdrucksmittel. Diese Musik besitzt im höchsten Maße das, was man Stil nennt. Wir wissen aus dem Briefwechsel mit Ernest Chausson, daß Debussy jeden Takt, jede harmonische Wandlung genau bedachte. Zehn Jahre hat Debussy an diesem Werk gearbeitet. Das Resultat war, daß sich in dieser von einem stets wachen Kunstverstand kontrollierten Partitur keine banale Wendung und kein grober orchestraler Effekt findet. Trotzdem die 13 Bilder des Stückes in das gleiche mattleuchtende Dunkel getaucht sind, gelingt es Debussy, dramatische Höhepunkte zu schaffen und — nach dem wichtigsten Kunstgesetz, dem des Wechsels — jeder Szene ihre besondere Nuance.zu geben.
Die Aufführung unter Roger D£sor-mierts durch das Ensemble der Pariser Großen Oper kann als authentisch gelten. Die Hauptdarsteller: Irene Joachim (Melisande), die Enkelin des großen Geigers und Brahms - Freundes Joseph Joachim, Willy Clement (Pelleas), Etchc-v e r r y (Golo) und die Träger der Nebenrollen boten eine stilistisch, darstellerisch und gesanglich gleichermaßen hervorragende Leistung. Die Sprechkultur dieser Künstler ist so hoch, daß man — trotz der fremden Sprache — jedes Wort verstehen konnte. Das danken wir allerdings nicht allein ihrer kultivierten und deutlichen Aussprache, sondern auch der rezitativischen Behandlung großer Partien der Singstimme, der sehr geschickten und durdisichtigen Orchestrierung und der zurückhaltenden, aber deshalb nicht weniger klangschönen Begleitung durch die Philharmoniker, die sich in erstaunlich kurzer Zeit mit dem ungewohnten Stil des Werkes vertraut gemacht hatten. Inszenierung und Kostüme entsprachen weder in der Qualität noch im Stil dem Drama Maeterlincks und der Musik Debussys. Es erscheint sehr fraglich, ob ein zeitgenössischer Künstler das wird nadiholen können, was die Malerfreunde Debussys seinerzeit — leider! — versäumt haben.
Fünfzig Jahre nach der Beendigung des ersten Partiturentwurfes und 44 Jahre nach der Uraufführung hat Debussys Oper ihre Lebensfähigkeit aufs neue glanzvoll bewiesen. Alles Negative, was die Kritik bis vor kurzem diesem Werke nachsagte, erweist sich bei unbefangenem Hören und aufmerksamer Prüfung als hinfällig. Weder läßt die innerdramatische Spannung nadi, noch ermüdet die impressionistische Musik das Ohr. (Insofern höchstens, ah niemand drei Stunden lang mit unverminderter Aufmerksamkeit eine soldie Fülle von Einzelschönheiten aufzunehmen vermag.) Es wäre deshalb, zumal „Pelleas und Melisande“ in Wien seit 18 Jahren nicht mehr gespielt wurde, sehr verdienstvoll, das Werk in das Repertoire der Staatsoper aufzunehmen. Sänger und Orchester würden mit einem neuen, vornehmen Aufführungsstil innig vertraut — von dem man sich wünscht, daß er auch auf die Darbietung anderer Opernwerke ein wenig abfärben möge —, Musiker und Musikfreunde aber hätten Gelegenheit, ein Standardwerk der französi-sdien Musik kennenzulernen, über welches Andre Maurois eine seiner Rom ingestalten sagen läßt: „Die ganze moderne Musik stammt davon ab
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!