Im Schatten der Vorgängerproduktion
Ein Abend auf hohem Niveau, der dennoch Wünsche offen ließ: "Pelléas et Mélisande", die letzte Staatsopernpremiere dieser Saison.
Ein Abend auf hohem Niveau, der dennoch Wünsche offen ließ: "Pelléas et Mélisande", die letzte Staatsopernpremiere dieser Saison.
Debussys einzige Oper - "Pelléas et Mélisande", derzeit an der Staatsoper zu sehen - ist ein besonderes Werk. Das dokumentiert sich auch in der Geschichte der Schallplatte. Intime Branchenkenner werden nie müde darauf hinzuweisen, dass Herbert von Karajans Einspielung mit den Berliner Philharmonikern, Richard Stillwell und Frederica von Stade in den 1970iger Jahren die aufwändigste Studioproduktion einer Oper gewesen sein soll. Trifft sie oder Claudio Abbados gegenüber der Premiere an der Wiener Staatsoper 1988 in einigen wesentlichen Partien veränderte Schallplattenaufnahme mit den Wiener Philharmonikern, François Le Roux und Maria Ewing den spezifischen Ton nicht noch besser?
Literaturoper
Aber hat nicht schon der Mitschnitt einer konzertanten Aufführung im Herkulessaal der Münchner Residenz 1971 mit den Ensembles des Bayerischen Rundfunks unter Rafael Kubelik, Nicolai Gedda und Helen Donath den interpretatorischen Maßstab für dieses "Drama lyrique en 5 actes" nach einem Text von Maurice Maeterlinck gesetzt? Nicht zu vergessen die exzellente Londoner Aufnahme von Pierre Boulez mit George Shirley und Elisabeth Söderström! Auch deswegen bemerkenswert, denn in seinen früheren Essays sprach Boulez nicht gerade bewundernd über diese Oper, charakterisierte sie als "eine Art von dünnem poetischem Aufguss, im abschätzigen Sinn des Wortes, bei dem man nicht recht weiß, warum die Konflikte eintreten, unglaubwürdig, wie sie werden, wenn sie sich zwischen Personen entwickeln, die nie ein Wort lauter als das andere aussprechen dürfen". Ein "Nebel aus dreizehn Bildern" betitelte denn auch der profunde Opernkenner Ulrich Schreiber seine scharfsichtige Analyse von "Pelléas et Mélisande".
"Pelléas et Mélisande" ist allein deshalb eine besondere Oper, weil dieses Eifersuchtsdrama zwischen den beiden Halbbrüdern Pelléas und Golaud und dessen geheimnisumwobene Gattin Mélisande, die durch ihre Liebe zu Pélleas die Dramatik dieses Geschehens auslöst -nicht mit den üblichen Arien und Ensembles aufwartet, sondern mit weiten, quasi "unendlichen" rezitativischen Abschnitten. Zudem begründet sie den Typus der Literaturoper. Die im Libretto ausgebreitete Symbolik wird allerdings weniger durch die mit subtilem Sprechgesang aufwartenden Protagonisten dechiffriert als durch den Orchesterpart, welcher mit zahlreiche Leitmotiven konfrontiert: Laut der frühesten Analyse dreizehn, mittlerweile hat man 36 herausgefunden. Auch daran lässt sich die Komplexität dieses sich üblichen Kategorien entziehenden Fünfakters zeigen.
Dies erklärt außerdem, weshalb es dieser Debussy nicht zu den Reißern der Opernliteratur gebracht hat, und es sich bei dieser Produktion erst um die vierte der Wiener Staatsoper handelt.
Das Fazit? So sehr dieser Debussy um das Thema Wasser kreist, so sehr hätte man dieses Ambiente sehr viel atmosphärischer suggerieren können als in diesem von der Idee einer Wehr inspirierten, schmucklosgrauen Einheitsbühnenbild von Marco Arturo Marelli, der die Geschichte zwar unprätentiös, aber nicht allzu fantasievoll erzählt. Wie sie ausgeht, besser: ausgehen könnte, überlässt er dem Besucher. Offensichtlich hat er sich zu sehr von einem Satz Maeterlincks beeindrucken lassen: "Sobald wir es aussprechen, entwerten wir es seltsam." Ob das auch für einen Regisseur gedacht ist?
Eine Überraschung, dass der erst jüngst zum Kammersänger ernannte, in einem unpassenden Schnitzler-Outfit (Kostüme: Dagmar Niefind) auftretende Adrian Eröd bei aller Phrasierungsintelligenz und Artikulationsklarheit nur wenig mit der Figur des Pelléas anzufangen wusste, der damit über kultivierte Blässe selten hinaus kaum. Da lebte Olga Bezsmertna, auch das ein Rollendebüt, ihre Rolle als Mélisande ungleich intensiver. Selbst wenn sie das Geheimnisvolle, letztlich Unerklärbare ihrer Gestalt und deren Agierens nur andeutungsweise deutlich machen konnte. Da hätte die Regie mehr eingreifen müssen.
Fabelhaft: Simon Keenlyside
So wenig wie Bezsmertna ihre große Vorgängerin in dieser Rolle, Frederica von Stade, vergessen machen konnte, war dies auch bei der Protagonistin der außerdem unvorteilhaft kostümierten Geneviève der Fall. Denn an Christa Ludwigs Gestaltungskraft und -intensität kam die sich zu zögerlich an ihre Aufgabe herantastete Bernarda Fink nicht heran. Ob hier mitgespielt hat, dass es ihr erster Auftritt im Haus am Ring war?
Maria Nazarova gab einen sich steigernden Yniold, der mit schwarzer Brille und Tropf auftretende Franz-Josef Selig einen untadeligen Arkel. Rollendeckend Marcus Pelz als Arzt. Das Ereignis war der in jeder Hinsicht fabelhafte, weil sängerisch fulminante, darstellerisch in allen Situationen überzeugende Simon Keenlyside als egomanischer Bösewicht Golaud. Das war großes, aufregendes Musiktheater. Von Alain Altinoglu am Pult des gut studierten Staatsopernorchesters hätte man sich ein stärkeres Augenmerk auf die differenzierte Farbenpalette und irisierenden harmonischen Wendungen der Partitur gewünscht - vor allem eine ungleich spannendere Tempodramaturgie.
Pelléas et Mélisande
Staatsoper, 24., 27., 30. Juni
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

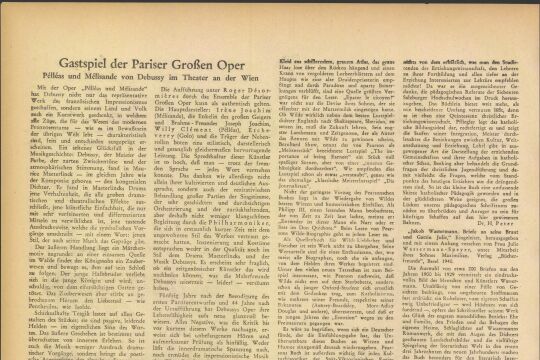



































































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)













