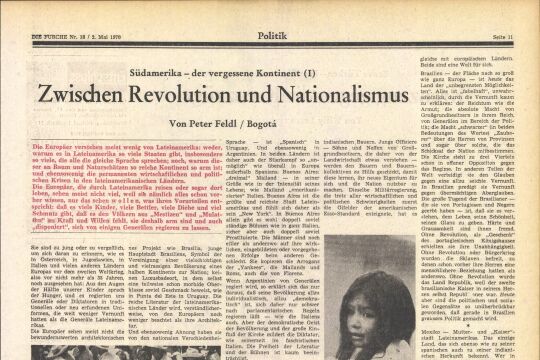Der Feminismus nützt den Indianerinnen in Mexiko nichts. Sie bleiben moderne Sklavinnen bürgerlicher Frauen. Nur ein Feminismus, der auch Klasse und Rasse miteinbezieht, kann wirkliche Befreiung schaffen.
Im letzten Winkel Mexikos. Chetumal ist eine wenig attraktive Stadt an der Grenze zu Belize auf der Halbinsel Yucatan. Die landschaftlich monotone Kalkplatte weist nach Chiapas den höchsten Indianeranteil Mexikos auf. In einer Lehmhütte sitzt eine junge Frau, gestikuliert wild mit den Händen und sagt: "Natürlich kämpfen wir gegen die Ungleichheit von Mann und Frau, aber ich bin doch keine Feministin! Natürlich werden wir Frauen hier ausgebeutet, haben weniger Rechte als die Männer. Wir sind uns dessen bewusst und lassen uns das nicht gefallen. Aber ich wiederhole: Wir sind keine Feministinnen."
Tilita Rodríguez ist 26 Jahre jung, Alleinerzieherin, Mitarbeiterin des Vereins "Indigene Frauen und ihre Rechte" und Maya-Indianerin. Das bedeutet auf der sozialen Rangordnung in Mexiko ganz unten zu stehen. Ihr karges Brot verdient sie als Hausmädchen bei einer reichen Anwaltsfamilie in der "Perle der Karibik", wie sich Chetumal arg beschönigend selbst bezeichnet. Neben Tilitas Arbeitskraft, die gegen ein minimales Gehalt ausgebeutet wird, ist auch ihr Körper nicht vor Übergriffen gefeit: So hätte sie vor allem den pubertären Söhnen des Hauses als Initiationsobjekt zur Verfügung zu stehen. Vergewaltigungen seitens des Hausherren gehörten zur Tagesordnung. Warum sie dann nicht andere Arbeitgeber sucht? Wenigstens die Hausherrin behandle sie korrekt, meint Tilita, und die Erfahrung ihrer Freundinnen bestätigen, dass die Situation für Indianerinnen überall gleich schlecht sei.
Frau ist nicht gleich Frau
An Tilitas Aussagen kann exemplarisch die Vielschichtigkeit eines mexikanischen Feminismus abgelesen werden, der bislang einseitig die Rechte der mexikanischen Frau ohne Rücksichtnahme auf Rasse und Klasse eingefordert hatte, und mit dem sich Tilita nicht identifizieren will und kann: "Für uns Indianerinnen hat Feminismus mit einer Realität zu tun, die nicht die unsrige ist. Das ist ein Wort für die Frauen in der Stadt und Frauen einer ganz anderen Schicht, die in einer anderen Welt leben und sich mit ganz anderen Problemen konfrontiert sehen." So bringt Tilita ein grundsätzliches Problem des Kampfes der Frauen um Gleichberechtigung in einer so ungleichen Gesellschaft wie der mexikanischen auf den Punkt: Es gibt viele Feminismen, und die können durchaus von Rassismus und einem internen Kolonialismus geprägt sein.
Denn Frau ist eben nicht gleich Frau, und Indianerinnen haben es jetzt satt, doppelt unterdrückt zu werden: nicht nur von ihren eigenen Männern, sondern durch die eigenen Geschlechtsgenossinnen: "Innerhalb der Frauenbewegung im Mexiko werden wir unter dem exotisch Anderen subsummiert und auf feministischen Kongressen zum Schweigen verurteilt. Wir sind moderne Sklavinnen der bürgerlichen Frauen! Und ermöglichen ihnen so ihre Karriere!"
Kirche hilft Indianerinnen
Es vergingen rund vierzig Jahre, bis sich ein indigenes, dezidiert geschlechtspezifisches Bewusstsein in Mexiko zu zeigen begann. "Wir waren die Begleiterinnen auf den Veranstaltungen, die von unseren Männern inhaltlich bestimmt wurden. Wir haben uns um ihren Ablauf gekümmert, doch hatten wir nie die Chance, Entscheidungsträgerinnen zu werden", erinnert sich die TzotzilIndianerin Camelia, die 1974 an dem mittlerweile historischen "Indigenen Kongress" in Chiapas teilnahm und dort zumindest die Möglichkeit zur Vernetzung mit Indianerinnen aus anderen Teilen Mexikos nutzte.
Nicht nur die durch den Erdölboom der siebziger Jahre erzeugten veränderten Anforderungen an Frauen, auch die katholische Kirche trug zur Diskussion über Ungleichheit zwischen Mann und Frau bei. In San Cristobal de las Casas entstand darum Ende der achtziger Jahre aus einer Kirchenvereinigung heraus die Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), die erste indigene Frauen-Organisation in Chiapas. Neben der Kirche und der feministischen Selbstorganisation waren es diverse NGOs und offizielle Integrationsprogramme der Regierung, die die Wahrnehmung für geschlechtsspezifische Ungleichheiten schärften.
Einzelne Schritte waren die notwendige Voraussetzung für das von den zapatistischen Frauen zu Jahresbeginn von 1994 entworfene Gesetz Ley Revolucionaria de Mujeres (Revolutionäres Frauengesetz). Es ist dezidiert auf die Bedürfnisse der indigenen Frauen zugeschnittenen, und als solches bislang das einzige in Mexiko. Darin fordern die zapatistischen Rebellinnen unter anderem das Recht auf politische Mitsprache und auf ein Leben ohne sexuelle und familiäre Gewalt, das Recht auf Entscheidungsfreiheit in Fragen der Fortpflanzung und der Wahl des Ehegatten, Recht auf Erziehung und Gesundheitsversorgung und faires Gehalt.
Sind die Punkte auch nicht allen indigenen Frauen im Detail geläufig, weiß frau immerhin von seiner Existenz. "Es ist vor allem die symbolische Ebene des Gesetzes, die allen bekannt ist, inzwischen auch unseren Männern, die darauf zu Beginn noch mit Unverständnis und Ärger reagiert haben." Cecilia erinnert sich an Vorfälle auf einem indigenen Treffen im Jahr 2001, wo männliche Teilnehmer nach der Behandlung von "Frauen-Themen" ungeduldig des Besprechen "wichtiger und ernster Angelegenheiten" verlangt hätten.
Ehebruch verboten
Indigener Feminismus eckt nicht nur bei den eigenen Männern an. Bürgerliche, urbane Feministinnen müssen sich nun Ethnozentrismus und Rassismus vorwerfen lassen sowie einen klassenunspezifischen Zugang zur Frauenfrage: "Mexiko ist nun mal ein multikulturelles Land, zu dessen Heterogenität man endlich stehen sollte, nicht nur als Verkaufsstrategie für den Tourismus. Und diese Heterogenität impliziert Differenz, auf die adäquat reagiert werden muss." Gerade am Ley Revolucionaria de Mujeres zeigen sich offen die Differenzen zu einem urbanen Feminismus: "Man kritisierte uns für das im Gesetz verankerte Verbot der Untreue, man bezeichnete es als katholisch reaktionär. Mag sein, doch wir, denen aus der Tradition unserer Kultur heraus Nachteile gegenüber den Männern erwachsen, müssen uns eben anders als unsere Kolleginnen schützen", meint Cecilia.
1997 formierte sich das Comité Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), das Frauen von rund zwanzig Ethnien versammelt. Auch diese verweigern strikt die Bezeichnung "feministisch", auch wenn ihr starker geschlechtsspezifischer Ansatz nicht zu übersehen ist. Er wird von vielen dennoch als "indigener Feminismus" bezeichnet. Dieser muss sich erst gegen den vereinnahmenden Diskurs der weißen und mestizischen Frauen behaupten.
Rassistisches Redeverbot?
Indigene Frauen beschwerten sich auf diversen nationalen Frauen-Treffen über die Nichtbeachtung ihre Anliegen. So würden Mestizinnen wie selbstverständlich die Führerschaft und das Wort übernehmen und "indigene Angelegenheiten" auf später verschieben. So kam es öfters vor, dass Indianerinnen in den Kongressmemoiren keine Spuren hinterließen, da man sie nicht sprechen ließ. Ihre Probleme existierten ganz einfach nicht. Um nicht wieder an der Rand gedrängt zu werden, beschlossen indigene Frauen kurzerhand, Mestizinnen nur als Zuhörerinnen auf dem ersten Treffen des Congreso Nacional de Mujeres Indígenas zuzulassen. Die Reaktionen waren heftig: "Separatistisch" und "rassistisch" wäre dieses Vorgehen, das zum ersten Mal den nicht-indigenen Frauen das Schweigen gebot und indigenen Frauen das Sprechen ermöglichte.
Der Kampf ist also an beiden Fronten eröffnet, und das Ziel ganz klar: "Aus der Differenz heraus unseren eigenen Weg zu gehen und dann die Kontakte zu den anderen Frauenbewegungen zu suchen. Denn auch sie können einiges von uns lernen." Und europäische Feministinnen ebenso.
Die Autorin ist freie Journalistin.