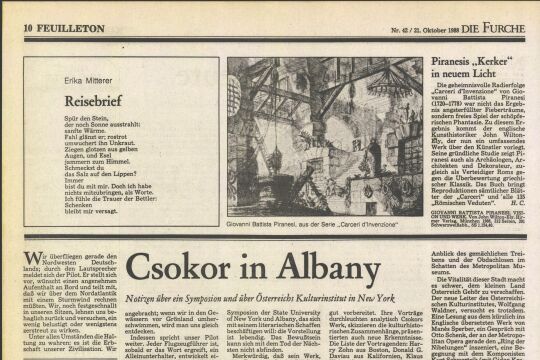Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tradition lastet
Wien im Abschiedstaumel von Staatsopernchef Lorin Maazel. Die einen triumphieren, daß der Stardirigent schon nach der Vertragshalbzeit aufgegeben hat und nach einem spektakulären Kleinkrieg in einem Brief an Unterrichtsminister Zilk Dirigier- und Komponiergründe (er-) fand, um von einer Vertragsverlängerung Abstand zu nehmen; die anderen rechnen bereits mit ihm ab, als ob er aus den USA nie wieder auf seinen Direktorsessel zurückkehren wolle.
Auf der anderen Seite präsentierte der Unterrichtsminister bereits nach einem Parforceritt in Sachen Bundestheaterdirektoren den neuen Staatsopernchef: Claus Helmut Drese, der in neunjähriger zäher Aufbauarbeit Zürichs Opernhaus auf ein Niveau hievte, daß Opernfreunde heute mit Recht Pilgerreisen zu seinen legendär gewordenen Produktionen der Werke Monteverdis und Mozarts antreten.
Der Rummel um Maazel war nun tatsächlich spektakulär. Und ist wohl noch lange nicht zu Ende. „Ich bin kein texanischer Opernstatist", hatte der Minister sich empört, als Maazel nach Verhandlungen um eine Änderung seines Sechsmonatevertrags — aus steuerlichen Gründen — kurzerhand über Fernschreiber rattern ließ, daß er auch schon für die Zeit „nach Maazel", also nach 1986, plane.
Das war jedenfalls der Auftakt zu immer neuen brieflichen Auseinandersetzungen mit dem Minister gewesen, in denen Maazel nicht müde wurde, sich als den größten Operndirektor nach Gustav Mahler darzustellen. In Interviews zwischen New York und Tokio behauptete er schlichtweg, daß an der Wiener Oper in den vergangenen 25 Jahren kaum Qualität vorhanden gewesen wäre—man kann sich vorstellen, was etwa Herbert von Karajan dar-
über dachte, der schließlich bis 1964 Opernchef war — usw.
Claus Helmut Drese, schon vor Jahren Wunschkandidat des Bundestheatergeneralsekretärs Robert Jungbluth, bringt dafür viele Voraussetzungen mit. Als „erfahrenster deutscher Theaterdirektor", der Kölns Theater auf-und Zürichs Oper ausgebaut hat und jetzt für die Wiedereröffnung des total umgebauten Züricher Hauses rüstet, sieht Wien als Krönung seiner Laufbahn. Ein Mann, der streng prüft und abwägt, wo Stärken und Schwächen liegen.
Wiens Schwächen hat er sofort gesehen: sie liegen in der szenisch-optischen Entwicklung, da sei die Staatsoper zu konventionell, zu mutlos. Also will er manche und manches von dem bringen, was ihm in Zürich zu sensationellen Erfolgen verholfen hat, wie etwa Ponnelle und Harnoncourt, denen er als zweites Idealpaar Claudio Abbado und Giorgio Strehler gegenüberstellen möchte. Abbado, der Philharmonikerund Publikumsliebling, dem die Mailänder Scala nach seinem Rücktritt kürzlich allzu prompt Riccardo Muti als neuen künstlerischen Leiter vor die Nase setzte, soll dabei ständiger geistiger und musikalischer Betreuer des Hauses werden. Andere Namen, auf die Drese setzt, sind die Regisseure Götz Friedrich, Harry Kupfer, Otto Schenk und die Dirigenten Leonard Bernstein, Carlos Kleiber, Lorin Maazel und Zubin Mehta. Eine Luxusriege, die nach „Idealmischung" aussieht — und aussehen soll. Mehr will und kann er vorerst nicht sagen.
Seinem ungebremsten Optimismus setzt Drese selbst nur einen Dämpfer auf, der für sein Konzept zum geistigen Problem werden könnte: „Wien kann heute nicht mehr realistisch erfüllen, was die große Tradition fordert", sagte Drese kürzlich in einem Interview. „Das schafft Komplexe, Freudsche Fehlleistungen — und das wird möglicherweise problematisch." Ob ihm dieser Satz Freunde schaffen wird?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!