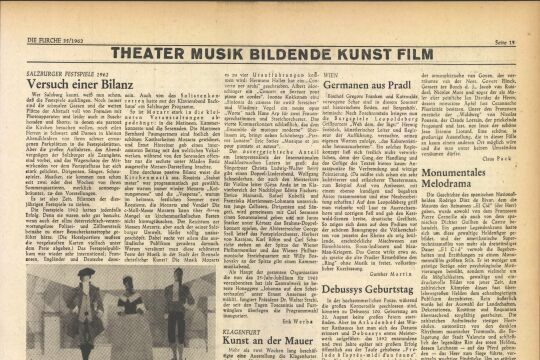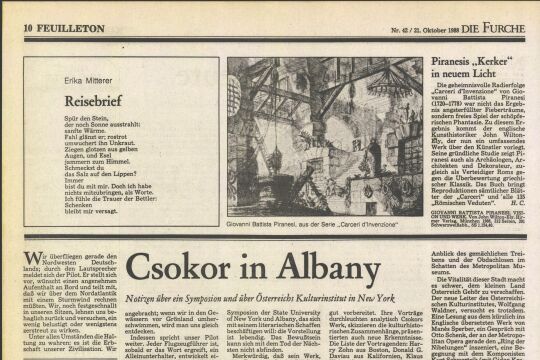Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aber nicht ohne Hoffnung
Noch pendelt er zwischen Zürich, wo er bis Juli 1986 das Opernhaus leitet, und Wien, wo er sein Amt als Opernchef im August 1986 antritt. Obwohl er sich in Zürich noch penibel um den Betrieb kümmert, hat er für Wien bereits gründliche Vorarbeit geleistet. Claus Helmut Drese, zwei-undsechzigjährig, aus Aachen gebürtig, leitete zuerst die Staatstheater Wiesbaden, führte dann die Bühnen von Köln und Zürich zum Erfolg. Ein Weltmann, der auf Form und Stil Wert legt, ein brillanter, kritischer Formulierer, der sich im Gespräch gern an Goethe hält und seinen Partnern gegenüber Offenheit, Pointen und Witz genau dosiert. Ein Opernhaus zu führen, nennt er offen auch eine Frage der Ideologie.
Oper - das ist für ihn die „Kunst des Möglichen”, mag sein, eine Seiltänzerei, manchmal sogar ohne Netz. Aber im Opernbetrieb „ist so wenig Freiraum für Utopien. - Da muß man das prekäre Gleichgewicht halten. Wo immer ich ein Theater geführt habe, arbeitete ich für die Stadt, die mich beauftragt hat und für ihr Publikum!” betont Drese. Er liebt zwar spektakuläre Ereignisse und Akzente im Theater, aber kokettiert doch auch mit dem Umstand, „nicht in die Theaterewigkeit eingehen zu wollen”. Er wolle zuerst und vor allem die Tradition pflegen, das Bewußtsein des Publikums erweitern, manchmal vielleicht unmöglich Scheinendes möglich machen, aber dabei alles so im Zaum halten, daß man den Boden unter den Füßen nicht verliere.
Seit Monaten plant er für Wien Premieren, legt den Tagesbetrieb fest und versucht im Spielplan seiner ersten beiden Wiener Jahre (bis 1988) jenes Gleichgewicht herzustellen, daß ein Hauch von „erstem Opernhaus” auch dort noch zu spüren ist, wo man — etwa aus budgetären Gründen und weil nicht jeder der 300 Spieltage ein Festtag sein kann — auf Spektakuläres verzichten muß. Drese bekennt sich da zur realistischen Betriebsführung. „Zehn Gebote” hat der Theatertheoretiker mit der pragmatischen Ader dafür aufgestellt: Diese reichen von der Pflicht des Opernchefs, immer anwesend, allgegenwärtig und für alle da zu sein, über die Verpflichtung, Phantasie und Mut zu zeigen, über die richtige Mischung von Ensembletheater und Starbetrieb und die Notwendigkeit, ein perfekter Diplomat zu sein, bis zum Grundsatz, daß es ohne Glück nicht gehe, aber man im Katastrophenfall nicht verzweifeln dürfe.
Den Wiener Spielplan der Ära Lorin Maazels und des „Einsprin-gers” Egon Seef ehlner beobachtete er genau, und registrierte Stärken und Schwachstellen. Bei über vier Dutzend Werken, die die Staatsoper im Repertoire verfügbar hält, fand Drese dennoch Lük-ken im Repertoire, die er durch Neuinszenierungen oder durch Zusammenarbeit mit großen
Opernhäusern auffüllen möchte, um „größtmögliche Farbigkeit” im Spielplan zu garantieren. So findet er, daß etwa Werke wie Verdis „Maskenball”, Mozarts .Jdomeneo”, Massenets „Werther” oder Bergs „Wozzeck” in hervorragenden Produktionen und Spitzenbesetzungen zu hören sein müssen. Stolz vermeldet Drese, daß er bereits im ersten Jahr 55 Werke im Spielplan haben werde, von denen sechs bis sieben neuproduziert oder ausgeliehen und rund zehn sorgfältig neustudiert werden. Und der Rest? „Es gibt immer Vorstellungen, von denen annehmbar ist, daß für Sänger, Chor und Orchester Verständigungsproben genügen. Da kann die Spannung sich sogar als Impuls für die Aufführung auswirken. Ich bin dagegen, jede Produktion zu Tode zu probieren.”
Eines der Hauptprobleme heutiger Spielplangestaltung sieht Drese im Halten gleichbleibender
Besetzungen. Für ihn ist jede gute Produktion „ein Markenartikel, der durch Sänger und Dirigenten das unverwechselbare Signum erhält”. Betreffend Staatsopern-Musikdirektor Claudio Abbado bedeutet das: Was er einstudieren wird - „Maskenball”, „Wozzeck”, voraussichtlich „Don Giovanni”, „Chowanschtschina” -, bleibt ihm vorbehalten. Er wird in den fünf Monaten, die er jährlich in Wien anwesend sein wird, diese Werke oft genug dirigieren.
Dreses Planungsarbeit reicht aber bereits bis in die neunziger Jahre, beispielsweise bei seinem Mozart-Projekt. Bis zum 200. Todestag Mozarts 1991 will er natürlich die großen Opern — „Lucio Silla”, „Idomeneo”, „Entführung aus dem Serail”, „Figaros Hochzeit”, „Cosi fan tutte”, „Don Giovanni”,. „Zauberflöte” und „Titus” — in beispielhaften Produktionen vorzeigen können. Oder zu Glucks 200. Todestag 1987 will er dessen „Orpheus und Eurydike” und „Iphigenie auf Tauris” als „notwendige Einstiege ins 18. Jahrhundert” verfügbar haben, wie er auch die Moderne durch Schönbergs „Moses und Aron”, Cerhas „Baal”, Einems „Danton”, Zimmermanns „Soldaten” und so manches andere Werk, das gemeinsam mit den Salzburger Festspielen produziert wird, repräsentiert sehen will.
Aus ihrer historischen Bedeutung heraus soll die Wiener
Staatsoper auch wieder Bezugspunkte zu Budapest und Prag finden - einen Anfang machen in der ersten Saison Antonin Dvofäks „Rusalka” (Inszenierung Otto Schenk) und Bartöks „Blaubart”.
Auf immer neue Projekte, immer neue Ideen stößt man im Gespräch, vom Opernstudio, dem er entscheidende Bedeutung für junge Sänger beimißt — „hat aber nur Sinn, wenn man die jungen Leute auch in den Aufführungen konsequent einsetzt!” - über die Reorganisation des Ballettbetriebes, die von den eben begonnenen Kollektivverhandlungen abhängt, bis zu den gewaltigen Aufgaben, um die er nicht herumkommt, wie einem neuen Wagner-„Ring”, oder Projekten, die dem Spielplan die unverwechselbar „wienerische Note” geben könnten, wie Ausgrabungen von Alexander von Zemlinsky, Franz Schre-ker oder von Karl Goldmarks „Königin von Saba”. Ist es ein Wunder, wenn er von dem Geschäft des Operndirektors als einer „schweren Bürde” spricht, mit dem Zusatz: „Aber ich habe einen guten Schlaf und das Prinzip Hoffnung!”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!