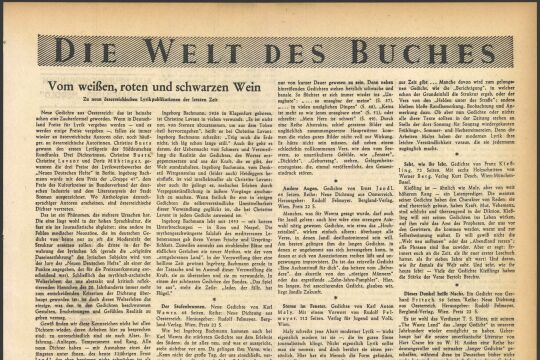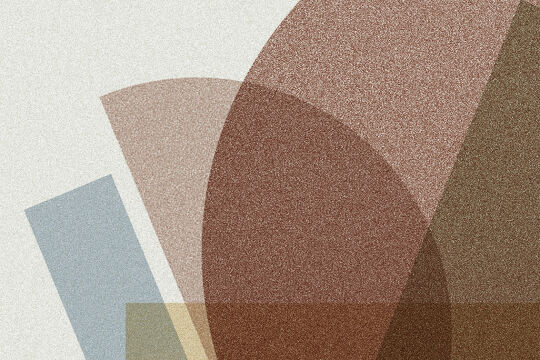Scharfsicht tut weh, auch der, die sieht
Mit dem Veza-Canetti-Preis zeichnet die Stadt Wien künftig schreibende Frauen aus. Am 1. Oktober 2014 wurde der Preis zum ersten Mal verliehen: an Olga Flor. Auszug aus der Laudatio, die Jurorin Daniela Strigl anlässlich der Preisverleihung hielt.
Mit dem Veza-Canetti-Preis zeichnet die Stadt Wien künftig schreibende Frauen aus. Am 1. Oktober 2014 wurde der Preis zum ersten Mal verliehen: an Olga Flor. Auszug aus der Laudatio, die Jurorin Daniela Strigl anlässlich der Preisverleihung hielt.
Die Wahrnehmung der Welt gehört zum Schriftstellerhandwerk wie zum Leben. Als substantielle Bedingung. Manche aber schauen genauer hin und sehen schärfer, nicht unbedingt weil sie das wollen, sondern eher weil sie gar nicht anders können. Olga Flor zum Beispiel. Oder Veza Canetti. Die natürlich, gerade in Österreich, auch in einer Tradition weiblichen Schreibens und Scharfblicks stehen: von Marie von Ebner-Eschenbach (nach ihr ist kein Preis benannt) bis zu Marlen Haushofer (nach ihr ist kein nennenswerter Preis benannt) und Elfriede Jelinek oder Marlene Streeruwitz.
"Man müßte sich angewöhnen, an den Menschen und Dingen vorbeizuschauen", heißt es einmal bei Haushofer, aber das geht eben nicht. Scharfsicht ist etwas, was Frauen in der patriarchalen Gesellschaft nicht gut ansteht, von ihnen wird eher der Einsatz des Weichzeichners erwartet, die Bereitschaft zur dezenten Retouche, schon bei der sinnlichen Wahrnehmung, "ihr glücklichen Augen", nach Ingeborg Bachmann, denen das Bild verschwimmt, ein Hoch der Kurzsichtigkeit.
Sichtbare Geistesgegenwart
Die Einrichtung des Veza-Canetti-Preises ist einerseits eine Reaktion auf die statistische Tatsache, dass auch in jüngster Zeit hierzulande nur etwa ein Drittel der bedeutenden literarischen Auszeichnungen an Frauen ging, andererseits gilt er der Sichtbarmachung genau jener Traditionslinie der - auch schmerzhaften - Aufmerksamkeit und Geistesgegenwart, die nicht nur denjenigen wehtut, die unter die Lupe genommen werden, sondern auch der Betrachterin.
Veza Canetti wurde von der Stifterin, der Stadt Wien, zur Patronin dieses neuen Preises erwählt, "da sie eine Vielzahl literarisch wirkender Frauen repräsentiert, die (und somit auch deren Werk) in der literaturwissenschaftlichen Kanonbildung vernachlässigt sind". Blickt man auf Veza Canettis Geburtsjahr 1897, dann könnte man bemerken, dass sie den Jahrgang mit Theodor Kramer teilt, der von der Germanistik ebenfalls lange übersehen wurde: Nichtbeachtetwerden ist kein weibliches Privileg. Aber bei Veza Canetti, die sich in ihren Pseudonymen "Magd" und "Knecht" nannte, kommt eben auch die prekäre Doppelrolle als Autorin und als Muse eines späteren Nobelpreisträgers dazu: "Die Frau verliert in der Liebe zu einem ausgezeichneten Manne das Bewusstsein ihres eigenen Wertes; der Mann kommt erst recht zum Bewusstsein des seinen durch die Liebe einer edlen Frau." So formuliert es Marie Ebner.
Olga Flors Selbstbewusstsein als Schriftstellerin ist eines des 21. Jahrhunderts. Mit ihren Figuren geht sie nicht gerade zimperlich um, sie entlarvt nicht nur, was sie denken, sie wendet es auch gegen sie. Von ihrem ersten Roman "Erlkönig" (2002) an hat Olga Flor diese unsere Gesellschaft im Fadenkreuz, in deren Blutkreislauf Kapitalströme fließen. Die Mitglieder der vor unseren Augen zerbröselnden Industriellenfamilie Maier-Meienstein agieren auf einem Untergrund, der sich, wie die Autorin in einem Essay darlegt, von einem patriarchalen Kapitalismus längst zur globalen Konzernherrschaft entwickelt hat, für die die parlamentarische Demokratie und ihre Politiker zusehends ein bloßes Rahmenprogramm abgeben. So gesehen passt dieser neue Preis, mit Verlaub, doch auch noch besser zum Werk Olga Flors als der gewiss bedeutende Anton Wildgans Preis der österreichischen Industrie, den die Autorin 2012 erhalten hat.
Asoziale Marktwirtschaft
Olga Flor reagiert seismografisch auf die verschärften Bedingungen der asozialen Marktwirtschaft unserer Tage, und sie reagiert subtil. Sie zeigt: die industrielle Revolution frisst ihre Kinder und Kindeskinder, egal ob die mitmachen oder sich dagegenstemmen. Die Nichte des Patriarchen pflanzt sich selbst in die Baumschule des Wirtschaftslebens und verkümmert doch ganz und gar.
Auch in "Talschluss" (2006), einer zeitgemäßen Antwort auf Marlen Haushofers "Die Wand", versucht sich eine Frau als Teilnehmerin am großen DKT-Spiel: als Eventmanagerin und Organisationsexpertin. Die Ich-Erzählerin Katharina verkörpert die Maxime der Machbarkeit, aber, um es altmodisch zu sagen, glücklich wird sie dabei nicht. Weil sie einmal mit dem Sohn von Grete zusammen war, übernimmt sie die Organisation von deren Geburtstagsfest gegen bloßen Spesenersatz. Man ist ja en famille. Doch gerade die Innenansicht der bürgerlichen Familie ist alles andere als traut, auch wenn hier nichts Dramatisches geschieht. Brüchig der Zusammenhalt, matt die Gefühle, hohl die Worte. Wie Geld in mehr oder minder intimen Beziehungen den Besitzer wechselt und welche Macht es verleiht, dafür interessiert Frau Flor sich nicht weniger als Frau Canetti. Flors Heldinnen erkennen sich als Kollaborateurinnen der Herrschaft. Grete etwa bietet Psychotherapie für ausrangierte Arbeitskräfte, aufdass die, die keine Arbeit mehr haben, wenigstens an sich selbst arbeiten. Mutter Courage ohne Courage, Marketenderin des freien Marktes, die eine wie die andere: "Wir ziehen unsere Leiterwägen durch den freien Markt. Die feindliche Übernahme des Geistes durch die Maxime der wirtschaftlichen Verwertbarkeit hinterlässt eine Leere, in die wir vorstoßen können." Die Gesellschaft als ganze hat sich in einen Talschluss, in eine Sackgasse manövriert, und Olga Flor leuchtet die Düsternis geradezu liebevoll aus.
Der Wille, etwas zu ändern
Olga Flor sucht sich Themen aus, die ein gesellschaftliches Minenfeld eröffnen, das wäre noch keine Mutprobe, denn das gehört heute fast zum guten Ton; aber sie tut das nicht auf die kulinarisch-sensationelle Weise, sondern auf eine oft vertrackte und verquere. Sie zeigt die rücksichtslose Wahrheit des Körpers, ohne Verbrämung und Schonbezüge, das Unschöne der Ausscheidung, der Pathologie, des Alters, der Sexualität.
Mutig ist Olga Flor aber auch, wenn es nicht um Literatur geht, sondern um Politik. Immer wieder meldet sie sich mit essayistischen Interventionen gegen die Unappetitlichkeit autoritärer Ideologien (namentlich der Freiheitlichen), gegen Überwachungswut und mediale Bevormundung und die Zumutungen eines durchökonomisierten Lebens zu Wort. Olga Flor scheut sich auch nicht - und dazu gehört heute tatsächlich Mut, weil es überhaupt nicht cool ist -, dem "Postfeminismus" nachzutrauern. Und sie sagt es ausdrücklich, was man eigentlich nicht mehr sagen müssen sollte: dass es in unserem Land "Arbeits- und Sozialstrukturen gibt, die sich für viele Frauen als handfeste Benachteiligungen niederschlagen. Und benennen allein reicht nicht, man muss den Willen haben, etwas zu ändern."
Olga Flor hat sich dabei nie auf der sicheren Seite verbarrikadiert. Ihr Rückblick auf die eigene Kindheit kündet sarkastisch von der Schwerarbeit, die es nach wie vor bedeutet, eine Frau zu werden: "als mir auf einmal klar wurde, was mich von den Figuren in den Romanen und Reiseberichten, die mich am meisten faszinierten, unterschied, und das waren Polarforscher, Matrosen, die ich aufgrund irgendeines grundsätzlichen Missverständnisses für äußerst abenteuerlustige Gesellen mit einem interessanten Beruf hielt, Weltraumreisende, Ritter, Indianerhäuptlinge (Cooper'scher Ausformung) und ähnliches, verstand ich, dass aus mir eine Frau werden würde, und ich beschloss, dass das eine feine Sache wäre, und fasste den Plan, dass aus mir all das und noch viel mehr auf einmal werden könnte. Pippi Langstrumpf konnte das auch [...]. Und mir ist es ja auch wunderbar gelungen. Naja, fast."