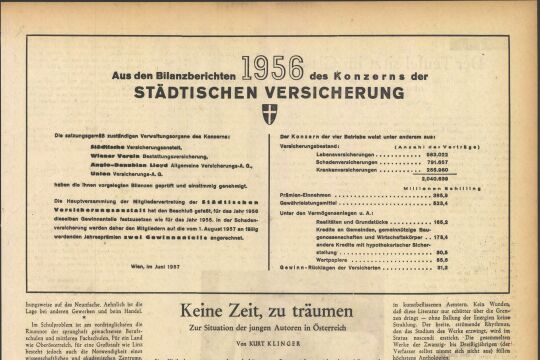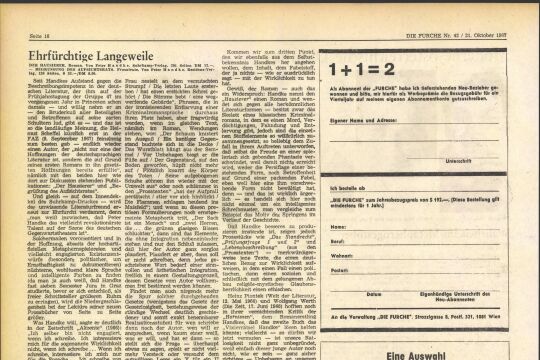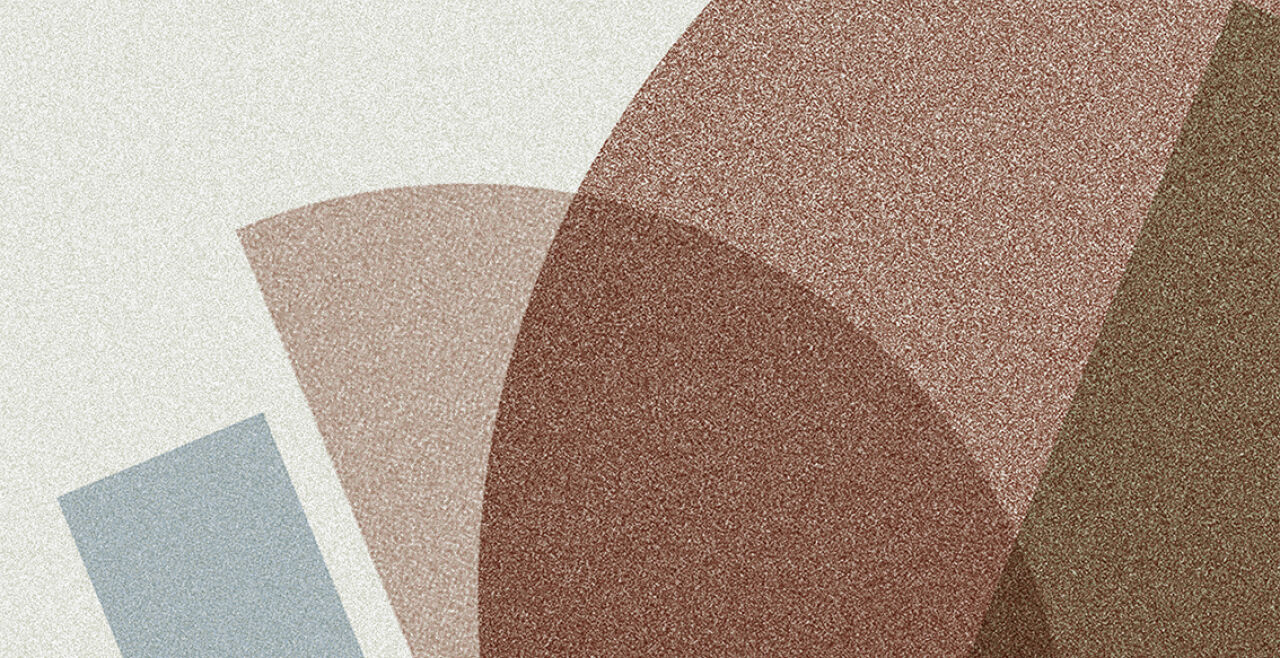
Wenn es im Inneren brodelt und kocht
Sprache als Präzisionsinstrument und Schutzschild: Elke Laznias zweiter Prosaband „Lavendellied“.
Sprache als Präzisionsinstrument und Schutzschild: Elke Laznias zweiter Prosaband „Lavendellied“.
Es gibt eine Menge aufzuarbeiten von dieser Erzählerin, der ein Leben unausgesprochener, unabgeklärter Leiden nachhängt. Jetzt rechnet sie in vierzehn immer knapper, intensiver werdenden Kapiteln mit Menschen aus ihrer Nähe ab, rechnet auf, was schiefgelaufen ist, rechnet nicht mit Wiedergutmachung, die nach all den Versäumnissen der Vergangenheit nicht zu bekommen ist. Und sie schließt nicht aus, an den inneren Verwerfungen ihres Lebens auch selbst Schuld zu tragen. Dabei entstehen mitunter schöne Szenen einer späten Annäherung, im Bewusstsein, dass diese auch nicht mehr zurechtzurücken vermögen, was jahrelange Vermeidungsenergie, sich mit einem Menschen der nächsten Umgebung auseinanderzusetzen, aus dem Lot gebracht hat.
Jetzt aber fasst die Erzählerin Mut, stellt sich der eigenen Geschichte, vergegenwärtigt sich, wo das Leiden seinen Ursprung hat, malt sich aus, wie man aneinander vorbeigelebt hat. „Weißt du“, schreibt sie, ein imaginäres Gegenüber unmittelbar ansprechend, dessen gemeinsame oder verpasste Geschichte ihr gerade nahegeht, und wechselt unversehens zum intimen „Wir“, in dem sich zwei kurz aufgehoben fühlen dürfen. „Weißt du noch“, so heißt die Formel, die über Erinnerungen Nähe stiftet. So direkt wird jemand aufgerufen, mit dem einmal Lebenszeit geteilt werden durfte.
Diese Prosa, der die marktgängige Bezeichnung Roman verwehrt wird, steht unter dem Zeichen der Vorsicht. Viel ist geschehen in der Vergangenheit, seelische Verletzungen zeugen davon, also soll die Sprache von weiterer Gewaltanwendung abgehalten werden. Elke Laznia ist mit ihrem Debüt „Kindheitswald“ (2014) als eine behutsame Autorin aufgefallen. Sie geht lieber in die Defensive als selber kräftig auszuteilen.
Auch in ihrem zweiten Prosaband – dazwischen erschien Lyrik: „Salzgehalt“ – geht es um Sprache und Form als die eigentlichen Träger des Bewusstseins. Natürlich lassen sich aus den einzelnen Kapiteln Geschichten ziehen, melancholische und lebenszugewandte gleichermaßen, doch bis sie soweit ist, etwas Erzählbares vorzutragen, muss sich der Leser durch das Sprachdickicht arbeiten. Nie nimmt Laznia den direkten Weg, um Erfahrungen weiterzugeben, das wäre ihr zu platt eindimensional. Die Haltung einer Autorin, die weiß, wie etwas gewesen ist, und das handfest und klar zum Ausdruck bringt, liegt ihr nicht. Das hängt mit ihrer Skepsis gegenüber der Tragfähigkeit der Erinnerung zusammen und der Weigerung, Sprache als reines Mitteilungsinstrument zu verwenden.
Neben einem Ereignis fallen einer hellwachen Berichterstatterin eine Menge an Nebengeräuschen, Stimmungen, Gedanken und Belanglosigkeiten auf, die allesamt zum Gesamtbild beitragen. Die Erzählerin hält fest, was sie erlebt hat, und im nächsten Augenblick kommen ihr Einzelheiten in die Quere, die nicht zählen für den Verlauf der Geschichte, die aber unbedingt erinnert werden müssen, um die innere Lage einer Person zu vergegenwärtigen. Diese Prosa zwingt einen zur Langsamkeit, weil es auf all diese Kleinigkeiten ankommt, um einer Figur nahezukommen. So entsteht eine konsequent subjektive Literatur, in die man sich nicht hineinstürzt, um andere Schicksale zu teilen, um mitzuleiden, mitzufühlen, auf dass man sich in einer Erlebnisgemeinschaft aufgehoben fühle. So wie diese Erzählerin auftritt, borgt sie sich die Sprache als Schutzschild, mit dem sie Leser auf Distanz hält.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!