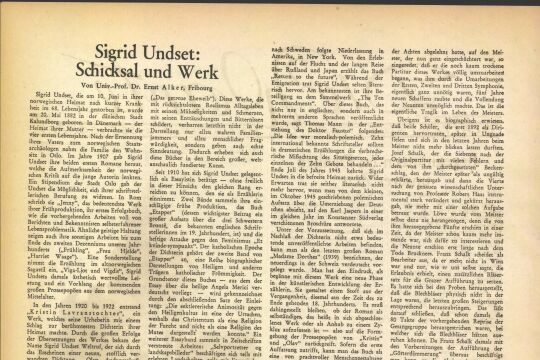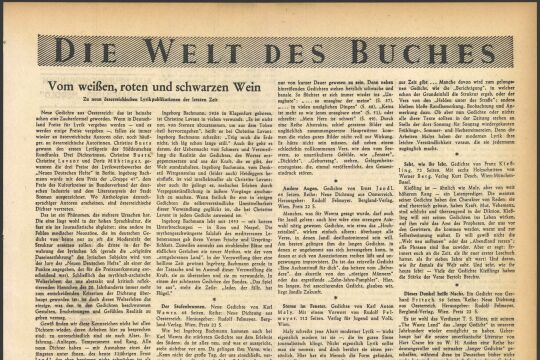Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Uber die Wachsamkeit von Träumen
Der Sprach- und Märchenforscher Wilhelm Grimm hat einmal eine Art von Erzählungen des Romantikers Achim von Arnim folgendermaßen charakterisiert: „Sie gleichen Bildern, die von drei Seiten einen Rahmen hatten, an der vierten aber nicht, und damit immer weiter fortgemalt waren, so daß in den letzten Umrissen Himmel und Erde nicht mehr zu unterscheiden waren, woraus eine ängstliche Ungewißheit für den Leser entsprang." Diese Worte könnten muta-tis mutandis auch auf die Dichtungen von Ilse Aichinger bezogen werden.
Da ist einmal jene Ungewißheit, welche die Dichterin kurz nach dem letzten Krieg zu ihrem „Aufruf zum Mißtrauen" veranlaßte, einer bitteren Bilanz der Zustände von damals. Ihr bisher einziger Roman „Die größere Hoffnung" (1948), aus dem letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges, geht unter Kindern vor sich, die durch ihre Abstammung rassisch Gezeichnete sind und in einer Welt ständiger Ängste leben, stets bedroht von einer lieblosen Welt. So wird das Reich des Traumes zur wahren Welt dieser Stiefkinder des Schicksals: „Träume sind wachsamer als Taten und Ereignisse, Träume bewahren die Welt vor Untergang und Tod." Das Buch ist kein biografischer Roman, doch Reminiszenzen an Durchlebtes und Durchlit-tenes sind zweifellos vorhanden.
Die am 1. November 1921 in Wien geborene Verfasserin schloß 1939 ihr Gymnasialstudium mit der Matura ab, wurde aber wegen der Abstammung von einer jüdischen Mutter zum beabsichtigten Medizinstudium nicht zugelassen. Nach Kriegsschluß reiste sie nach England, wo ihre Zwillingsschwester lebte. 1949 wurde sie Lektorin beim S. Fischer Verlag, 1950 ging sie nach Ulm an die Hochschule für Gestaltung. Dann widmete sie sich ausschließlich der Schriftstellerei und trat in Verbindung mit der von Hans Werner Richter gegründeten „Gruppe 47", der namhafte Autoren wie Heinrich Boll, Paul Celan, Ingeborg Bachmann und etliche andere angehörten, darunter auch Günter Eich, den sie 1953 heiratete. Für ihre „Spiegelgeschichte" erhielt sie schon 1947 den Preis der „Gruppe 47". Sie lebte dann im oberbayrischen Lenggries, schließlich in Großgmain bei Salzburg und wohnt derzeit wieder in ihrer Geburtsstadt Wien.
Entgrenzung der realen Welt
Ihre Eigenart offenbart Ilse Aichinger am markantesten in ihren Erzählungen und Dialogen mit dem fließenden Übergang vom Wirklichen zum Überwirklichen. Die Entgrenzung der realen Welt wird immer wieder spürbar, das Hinausragen über die Bezirke des rationalen Bewußtseins in die Bereiche des Traumes und des Unbewußten. Träume machen das Weite nah, das Unsichtbare sichtbar, sie suchen das Unauffindbare und holen das Geheimnis ein. Überwirkliche Szenen überwölben das reale Geschehen und offenbaren das wahre Sein.
Die Bände „DerGefesselte" (1953), „Wo ich wohne" (1963), „Eliza Eliza" (1965), „Schlechte Wörter" (1976), „Nachricht vom Tag" (1970), „Meine Sprache und ich" (1970), „Kleist, Moos, Fasane" (1987) variieren ihre Eigenart in einer sachlich referierenden Prosa mit surrealistischen Ausblicken. Mitunter fühlt man sich an Kafka erinnert, von dem die Dichterin, als sie 1983 in Klosterneuburg den Franz-Kafka-Preis erhielt, sagte: „Die Existenz von Kafka hat für mich immer Freude und Schrecken bedeutet, ein brennendes Seil über der mit den Jahren nachdunkelnden Welt."
Ihre Sprachskepsis, ein österreichisches Erbe, das sich von Hugo von
Hofmannsthal über Ludwig Wittgenstein bis zu den Vertretern der Wiener Gruppe und der konkreten Poesie verfolgen läßt, kommt an nicht wenigen Stellen zum Ausdruck. Doch sie experimentiert nicht mit der Sprache wie ein Emst Jandl oder Eugen Gom-ringer. Trotz mancher Erneuerung weiß sie sich den Wurzelkräften der Tradition verbunden und sagt schon in ihrem Roman: „Ihr wollt das Deutsche verlernen? Ich helfe euch nicht dazu. Aber ich helfe euch, es neu zu erlernen, wie ein Fremder eine fremde Sprache lernt, vorsichtig, behutsam, wie man ein Licht anzündet in einem dunklen Haus..."
Die frühe Erzählung „Die geöffnete Order" mit ihrer scharf konturierten Handlungsführung hat schon ein Kenner und Könner wie Werner Bergen-gruen besonders geschätzt. In der „Spiegelgeschichte" kehren zeitliche Abläufe sich um: Ein Mädchen lebt im Augenblick des Todes ihr Leben bis zur Geburt zurück. In der Dialogszene „Erstes Semester" will eine Studentin inein Heim für auswärtige Studentinnen aufgenommen werden. Im Gespräch mit der Pförtnerin wird nach und nach erkennbar, daß es die Pforte zur Ewigkeit ist, in die sie Einlaß begehrte. Im letzten Augenblick zieht sie den Fuß zurück, sie will im Diesseits bleiben und ist damit dem Leben zurückgegeben. Doch die der Zeit Verhafteten gehen am Wesentlichen vorbei und überschreiten nicht jene Grenzbereiche, wo bewegtes Leben in ruhendes Sein mündet.
In derartige Bereiche führen auch die Hörspiele der Dichterin. Hier haben zweifellos Lebensgemeinschaft und dichterische Zusammenarbeit mit ihrem Gatten Günter Eich, einem Meister des Hörspiels, literarische Früchte getragen. Greifbare Wirklichkeit und verschwimmende Traumbefangenheit stehen nebeneinander. Es gibt viele Antworten auf eine Frage, Sicheres kann unsicher werden. Fremdes wird bekannt, Allzubekanntes wird fremd. Eines der markantesten Hörspiele, „Knöpfe", richtet sich gegen den Mechanismus einer industriellen Arbeitswelt, in der individuelles Bewußtsein völlig verlorengeht: Die Arbeiterinnen einer Knopffabrik laufen Gefahr, zuletzt selbst zu Fabriksprodukten, zu Knöpfen zu werden.
Aichingers Gedichte, in vielen Anthologien und Zeitschriften verstreut erschienen, sind größtenteils in dem Sammelband „Verschenkter Rat" (1978) zusammengefaßt. Es sind Kurzgedichte ohne Reim und Strophen, prosaische Texte mit einer oft paradoxen Bildwelt und mit häufig unerwarteten Assoziationen, so wenn etwa ein Gedicht „Winteranfang" nicht mit einem Naturbild beginnt, sondern mit den Worten anhebt: „Im Fach liegt nichts mehr..."
Es geht um Dich!
Das Kurzgedicht „Mein Vater" läßt die Fremdheit gegenüber dem während der Hitlerzeit auf der anderen Seite stehenden Vater erkennen, der sich von seiner Frau hatte scheiden lassen. Gegen die Halbheiten im Dasein ist das Gedicht „Nachruf gerichtet in biblischer Einkleidung: „Gib mir den Mantel, Martin,/aber geh erst vom Sattel / und laß dein Schwert, wo es ist, / gib mir den ganzen." In anderen Gedichten muß der Leser manches mehr erahnen als erkennen.
Bei der Überschau über das Gesamtwerk werden viele empfinden: Die Dichterin ist, wenn auch oft in ungewohnter Metaphorik, bestrebt, die tiefen Augenblicke des Menschen zu erfassen und darzustellen: Das Eigenste, das ihm allein gehört, zu dem der Massenmensch der Gegenwart vor lauter Geschäftigkeit nicht mehr findet. Deshalb wird der Leser spüren: Du wirst hier angesprochen, um dich geht es, tua res agitur!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!