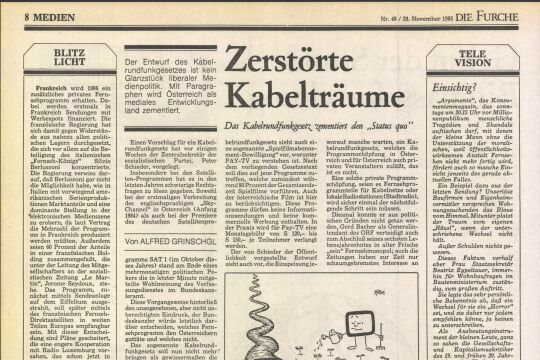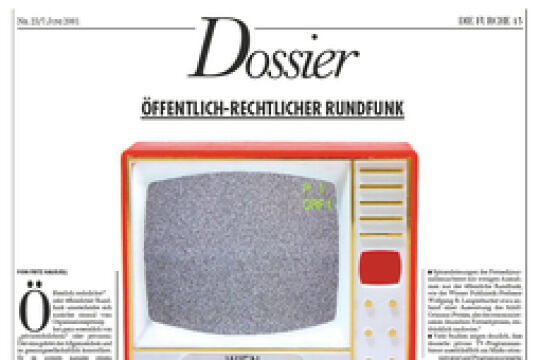Im Frühjahr soll der Nationalrat das neue ORF-Gesetz beschließen. Es bringt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einerseits 160 zusätzliche Euro-Millionen und andererseits den Auftrag, Spartenkanäle für Sport, Kultur und Information zu installieren.
Um die Priorität von Geldspritze oder Inhaltsgebot zu klären, lohnt ein Blick in die ORF-Geschichte: 1995, im Jahr eins unter Gerhard Zeiler, finanzierte sich das Unternehmen zu je 45 Prozent aus Werbung und Gebühr, das restliche Zehntel firmierte unter „Sonstiges“. 2008, im Jahr zwei unter Alexander Wrabetz, sorgte eine halbe Milliarde Programmentgelt für fast 50 Prozent der Einnahmen, und das „Sonstige“ überholte erstmals knapp die Werbung.
Wer unter „Sonstiges“ Grauzonen der öffentlich-rechtlichen Grenzüberschreitung vermutet, liegt kaum falsch. Das reicht vom Produktionskostenbeitrag bis zum Product Placement. Doch auch die fortschreitende Ökonomisierung kann den Publikumsverlust nicht stoppen. Von 1995 bis 2009 sank der Marktanteil des ORF-Fernsehens von 63 auf 39 Prozent.
Wo Quoten schwächeln, wird Content wichtiger. Public Value heißt das auf Denglish. Die Stärkung dieses öffentlichen Wertes ist offizielles Hauptziel des neuen ORF-Gesetzes. In der angeblichen Wissensgesellschaft dürfen wir dies sogar altmodisch Bildungsauftrag nennen. Er ist notwendiger denn je – angesichts eines Status quo, für den Armin Assinger die Olympia-Abfahrt kommentiert, während er zeitgleich im anderen Kanal die Millionenshow moderiert.
Die Hoch-Zeit von Club 2 über Österreich II bis Universum ist längst vorbei. Inhaltliche Innovationen setzen andere – vom Personality-Talk à la Maischberger über die History-Dokus eines Guido Knopp bis zu Galileo im Privatfernsehen. Acht Absätze des neuen ORF-Gesetzes widmen sich der Qualitätssicherung. Doch das zu Sichernde muss erst neu geschaffen werden.
* Der Autor ist Medienberater und Politikanalyst
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!