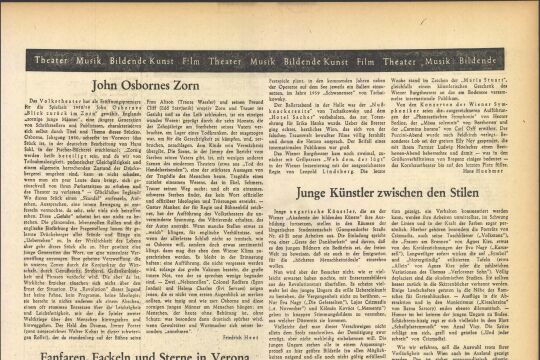Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
FILM
Wildwestdämmerung und Frauenschicksale
Die jahrzehntelange Legendenbildung um den Wilden Westen in seinem filmischen Konterfei ist allmählich einer Entmythologisie- rung gewichen. Die strahlenden Helden des Pionierzeitalters mit all seinen Auswüchsen der Gesetzlosigkeit haben sich bei näherer Durchleuchtung oft als fragwürdige Figuren erwiesen oder treten uns in der Optik Hollywoods als alte, müde Männer gegenüber.
Kein historischer Beitrag zur Geschichte des Wilden Westens, aber in dieses Denkschema passend, ist der Streifen „The shootist“ (Der Scharfschütze). Erzählt wird die Geschichte eines einst gefürchteten Revolverhelden, der 1901 in ein Wildweststädtchen kommt und dort erfahren muß, daß er an Krebs in fortgeschrittenem Stadium erkrankt ist und daher nur noch kurze Zeit zu leben hat. Er mietet sich in einer kleinen Pension ein und will dort in Ruhe den Tod erwarten, aber sein Leumund ist ihm auch in die Abgeschiedenheit nachgeeilt und ruft Bösewichte und skrupellose Geschäftemacher auf den Plan, was letztlich ein letales Ende für den „Helden“ bedeutet.
Die „Action“ des Films setzt erst am Schluß, der allzu schablonenhaft und durchsichtig ausgefallen ist, massiv ein. Vorher bemüht sich der Regisseur mit Erfolg um eine differenzierte Menschenzeichnung und um ein plastisches Zeitbild. Da wird eine Epoche der Pferdebahnen und der ersten Autos lebendig, und die Hauptfiguren entfalten Persönlichkeit und bleiben nicht in den herkömmlichen Westernklischees stecken.
Vor allem wurde der Film offensichtlich für John Wayne geschrieben. In dem gealterten, todkranken Wildwesthelden spiegelt sich viel von seiner Karriere und auch von seinem Privatleben wider, was so weit geht, daß Ausschnitte aus früheren Filmerfolgen des Hollywood-Veteranen eingeblendet werden. Wayne, der nun bald ein halbes Jahrhundert beim Geschäft und damit ein lebendes Monument des US-Films geworden ist, zeigt hier die wohl subtilste, reifste Leistung seiner Karriere. Regisseur Don Siegel, sonst eher ein Krimispezialist, konnte sich außer auf Wayne auf ein gescheites Drehbuch und auf weitere gute Altstars, Lauren Bacall und James Stewart, stützen und sein Team zu einer abgerundeten Leistung führen. Es ist gehobene, hinlänglich spannende Unterhaltung geworden,
Sicher nicht so leicht ans Publikum kommen dürfte Robert Altmans neuer Film „Drei Frauen“. Altman zählt seit jeher zu den unbequemen, schwierigen Regisseuren Amerikas, dessen Gesellschaft er nie mit Samthandschuhen angefaßt hat. Mit „M.A.S.H.“ war ihm ein ätzender Durchbruch gelungen, in „Nashville“ und „Buffalo Bill und die Indianer“ konnte er sich bereits als etablierter Erfolgsregisseur präsentieren.
Altman führt „Drei Frauen“ auf einen Traum zurück, den man als Beschauer allerdings als Alptraum empfindet. Hier ist alles von einer seelenlosen Kälte und Beziehungs- losigkeit, die diese - noch jungen - Frauen nicht zur Entfaltung und Selbstverwirklichung kommen und sie in ihrer ständigen Frustration und Entfremdung scheitern läßt. Dieses Krankheitsbild einer Gesellschaft, das Altmah offenbar vorschwebte, entwickelte er allerdings nicht mit der messerscharfen Psychologie eines Ingmar Bergman - auch hier anvisiert, aber nie erreicht -, sondern nur in pessimistischer Verstiegenheit seiner Figuren und Bilder. Erwähnt sei, daß Altmans Hausstar Shelley Duvall mit ihrer Darstellung in Cannes den weiblichen Schauspielpreis gewonnen hat, aber ebensowenig ein Ereignis ist wie ihre Partnerinnen Sissy Spacek (man kennt das Mädchen mit dem urwienerischen Namen vor allem aus „Carrie“) und Janice Rule.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!