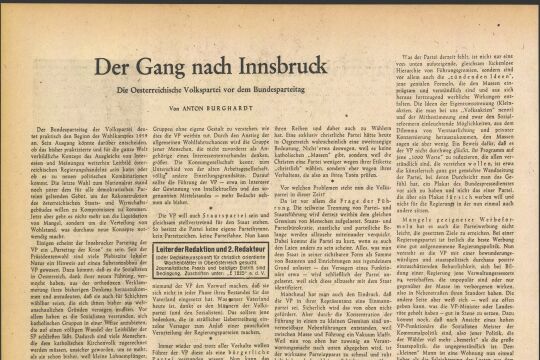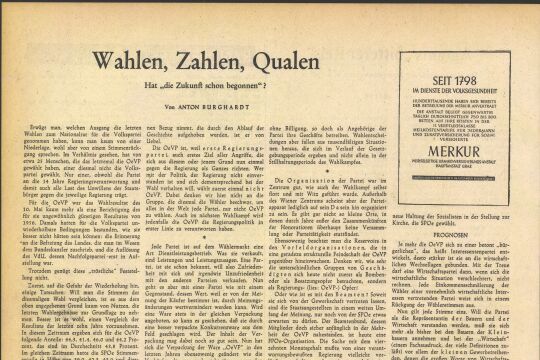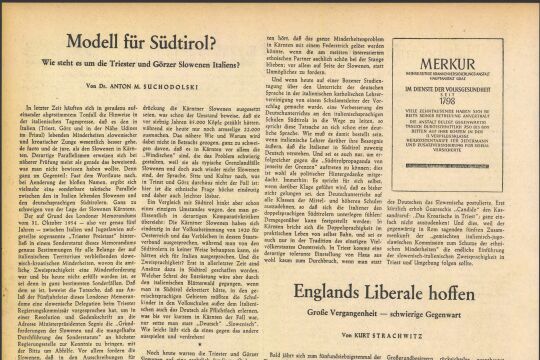Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Resonanz fur Unabhagige
Das Zweiparteiensystem erscheint den meisten Beobachtern als selbstverständlich mit der amerikanischen Form der Demokratie verbunden. Analytiker der politischen Wetterlage sehen für 1972 die Lage anders. Sie fühlen, daß sich die Atmosphäre geändert hat, weil loyale Parteimitglieder der Großparteien in steigendem Maße Parteidirektiven zu ignorieren beginnen und in der Stellungnahme zu Einzelpersönlichkeiten und Problemen unabhängig davon entscheiden.
Das Zweiparteiensystem erscheint den meisten Beobachtern als selbstverständlich mit der amerikanischen Form der Demokratie verbunden. Analytiker der politischen Wetterlage sehen für 1972 die Lage anders. Sie fühlen, daß sich die Atmosphäre geändert hat, weil loyale Parteimitglieder der Großparteien in steigendem Maße Parteidirektiven zu ignorieren beginnen und in der Stellungnahme zu Einzelpersönlichkeiten und Problemen unabhängig davon entscheiden.
Das erste Symptom war offensichtlich die Bürgermeisterwahl in New York, wo der liberale Republikaner Lindsay mit der Hilfe dissidentischer Demokraten und Republikaner und der „Liberal Party“ die beiden konservativen Kandidaten der Großparteien schlug. Der Wähler orientierte sich an Prinzipien, nicht am Parteibuch, Die Invasion Kambodschas mit der ihr folgenden Verbreiterung der Anti-kriegsbewegung, aber auch die Appelle der Administration an den Dissent, im Rahmen des Systems seine Ansichten zu vertreten, schuf einen neuen Antrieb, sich nach Methoden umzusehen, das in die Wirklichkeit umzusetzen. Angesichts der Tatsache, daß im Kongreß Abgeordnete beider Parteien dem Dissent nahestehen, schien die erste logische Antwort: Sorgt dafür, daß mehr Friedenskandidaten dahin gelangen. Wählt unabhängig von der Parteizugehörigkeit Persönlichkeiten, für die das zutrifft. Das Wählerreservoir für solche Kandidaten liegt bei der Jugend, den Farbigen, den armen Weißen und den Frauen, wenn sie sich zugleich mit der Antikriegsparole weitgehend der Position der Zdvilrechtsbewe-gung, der Minderheiten, der Studenten und der in erstaunlichem Maße Profil annehmenden Frauenbewegung annehmen, das heißt, eine linksliberale Haltung einnehmen.
Können das solche Männer in einer der beiden Großparteien? Mehr als ein Kenner der bürokratischen Prozeduren hat seine Zweifel. Nicht umsonst haben sich jüngst bei einer Rundfrage 42 Prozent der Wähler zwischen Einundzwanzig und Dreißig als „unabhängig“ bezeichnet.
Wenn und wo dazu im Lande das Wahlalter auf 17 Jahre herabgesetzt wird, dürfte sich die Zahl erhöhen. Und was freiwillige Wahlhelfer aus der Jugend bedeuten können, bewiesen 1968 die Vorwahlen der Demokratischen Partei für Eugene McCarthy und Robert Kennedy, auch wenn Major Daley, Johnson und der Gewerkschaftsboß Meany später die Nationalkonvention manipulierten.
Es mehren sich die Stimmen, die glauben, daß der Appell, den FDR vor langer Zeit an Wülkie gerichtet haben soll: „Laß uns die Liberalen aus beiden Parteien herausführen und eine neue Partei bilden!“ eine späte Resonanz findet.
Die nicht nur durch Kambodscha, sondern aiuch durch innenpolitische Fragen in Bewegung geratenen „Unabhängigen“ haben sich noch keineswegs entschieden: Soll man die Großparteien von innen her durch aktive und militante Beteiligung am demokratischen Prozeß verjüngen und im
positiven Sinne „radikalisieren“, das heißt, der. sich wandelnden Welt entsprechend „umfunktionieren“ oder in einer breiten Koalition der Reformer verschiedenster Richtungen in einer neuen Partei beginnen.
Es wird sich zu erweisen haben, wie in absehbarer Zeit die großstädtischen Slums, die Universitäten, die Negergruppen und etwa mit dem Status quo unzufriedene Kirchen reagieren werden, wenn die sich am Horizont zeigende Neuformierung Profil — und einen Sprecher zu präsentieren vermag, der noch einmal nach „new frontiers“ ruft.
Die Intellektuellen jedenfalls scheinen aufzuhorchen, wenn etwa Eugen McCarthy in „New York Times Magazin“ ausruft: „Eine dritte Partei könnte 1970 eine reale Kraft sein!“ McCarthy, der ausführlich auf die Geschichte „Dritter Parteien“ in Amerika während des 19. und 20. Jahrhunderts eingeht, glaubt nicht, daß man an ihren Beispielen viel lernen kann, sondern sieht die Gründe für die heutigen Möglichkeiten einer unabhängigen Partei in den speziellen Problemen, die der Beginn des 7. Jahrzehnts stellt. Beide Großparteien sind durch Frak-tionalisierung nicht in der Lage, als Ganzes ein eindeutiges Ja oder Nein zur Kriegspolitik zu sagen. Beide Parteien sind ihrer innerparteilichen Struktur nach überaltert und bei der Handhabung prozeduraler Techniken so gut wie immun gegenüber Reformen. Sie sind weitgehend verständnislos den Ambitionen, dem Lebensstil und den Emotionen der jungen Generation gegenüber. Der Autor ruft — noch — nicht zur Gründung der „Dritten Partei“ auf, aber seine Ausführungen zeigen ebenso wie wiederholte Reden Lindsays, der „neue Zentren“ außerhalb alter Parteibindungen überall im Lande fordert, daß allem Anschein nach zumindest ihnen, und nicht nur ihnen, die Zeit gekommen scheint, in der Öffentlichkeit unmißverständlich die Frage „Soll man?“ aufzuwerfen. Im Augenblick aber ist die ganze Diskussion noch im Stadium des Versuchsballons, von denen losgelassen, die die politische Landschaft prüfen wollen. Den Einwand, daß noch nie „Dritte Parteien“ etwas erreicht haben, parieren die Befürworter mit dem Hinweis auf die britische Labour Party, die das Duett Konservativ—Liberal liquidierte, und — auf die Republikanische Partei in Amerika, die, als erste „Dritte Partei“, die Whigs aus dem Sattel stieß.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!