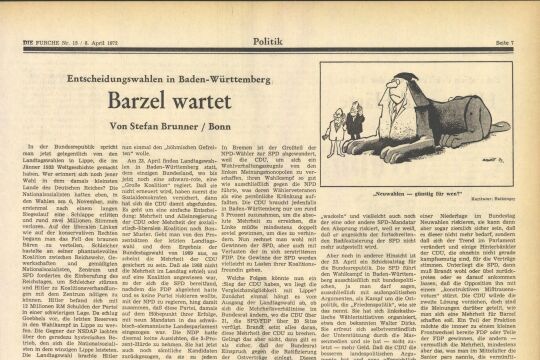Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bonn und die Alternativen
Die Zeiten sind längst vorbei, da die etablierten Parteien in der Bundesrepublik Deutschland die keimenden grünen und alternativen Bewegungen noch als flüchtige Erscheinung im politischen Spektrum betrachten konnten. Diese haben sich nämlich im Gegenteil als ausgesprochen zählebig entpuppt, sind gar im einen oder anderen Fall zu einer echten Konkurrenz für die in der Bundesrepublik agierenden Parteien geworden.
Die Zeiten sind längst vorbei, da die etablierten Parteien in der Bundesrepublik Deutschland die keimenden grünen und alternativen Bewegungen noch als flüchtige Erscheinung im politischen Spektrum betrachten konnten. Diese haben sich nämlich im Gegenteil als ausgesprochen zählebig entpuppt, sind gar im einen oder anderen Fall zu einer echten Konkurrenz für die in der Bundesrepublik agierenden Parteien geworden.
Das alles wäre weiter nicht schlimm, wenn es sich bei Grünen und Alternativen um Parteien im normalen Sinne handelte. Doch sie sind weder das in Reinkultur, noch entspricht ihre Auffassung von Politik und Demokratie dem Verfassungsverständnis der Bundesrepublik. Das und ihre gleichzeitig wachsende Attraktivität bei vorwiegend jungen Wählern macht sie zu einem Problem — für die Parteien wie für die Demokratie.
Das Wort von der grünen und alternativen Herausforderung führen die Politiker der etablierten Parteien so locker im Munde, daß der Verdacht angebracht ist, sie hätten den Ernst der Situation noch gar nicht so recht erfaßt. Viel vordergründige Phraseologie verdeckt im Grunde nur die verbreitete Ratlosigkeit, wie man den grünen Fischzügen in der jungen Generation entgegenwirken kann. Rezepte gibt es viele, Erfolge bisher keine.
Wo liegt das Problem? Die Grünen und Alternativen, häufig in Wahlbündnissen zusammengeschlossen wie die Grün-Alternative-Liste (GAL) in Hamburg, nützen auf eine frappierend unorthodoxe Weise die bei jungen Leuten verbreitete Abneigung gegen alles Etablierte aus. In der jüngeren Generation findet das nicht immer falsche Geschwätz von den „Machenschaften derer da oben" bereitwilliges Gehör.
Das Gefühl einer gewissen Ohnmacht, verstärkt durch modische, aber auch in die Tiefe gehende Trends, wie Friedenssehnsucht, Umweltbewußtsein, hat hier ein Potential geschaffen, das zu einem großen Teil von den etablierten Parteien nicht mehr angesprochen wird. Um so attraktiver werden für diese Leute Bewegungen, die wie die Grünen und Alternativen Basisdemokratie praktizieren, jedem ein Mitspracherecht einräumen, Aktion ganz groß schreiben.
Die Folge ist längst sichtbar: In sechs Landesparlamenten sind die Grünen mit eigenen Abgeordneten vertreten. Und nahezu alle Demoskopen sind sich sicher, daß bei kommenden Bundestagswahlen die Grünen auch in das Bonner Parlament einziehen.
Was dann? Zustände wie in Hamburg oder in Hessen, Unre-gierbarkeit der Republik also?
Unter all den Strategien, die die herkömmlichen Parteien entwik-keln, um mit diesem Phänomen fertig zu werden, hat eigentlich nur eine einzige realistische Chancen, etwas zu bewirken. Unter der Voraussetzung nämlich, daß es aufgrund der gängigen grünen Programmatik höchst unwahrscheinlich ist, daß sich Grüne und Alternative allmählich zu braven Teilnehmern am Kräftespiel in einer parlamentarischen Demokratie entwickeln, hat es wenig Sinn, sie mit normalen Parteimaßstäben zu messen. Die Koalitionsfähigkeit der Grünen wird wohl noch auf längere Sicht eine Wunschvorstellung vorwiegend linker Politiker sein.
Dafür aber bietet sich ein anderer Weg an: Man muß ihnen das Wasser abgraben. Anders ausgedrückt: Es gilt für die anderen Parteien, in gleicher Weise* attraktiv für das Wählerpotential der Grünen zu werden.
Natürlich kann das nicht heißen, sich nun eine grüne Fassade zuzulegen. Aber eine inhaltliche Auseinandersetzung mit grünem und alternativem Gedankengut kann schon einiges bewirken. Diese Strategie freilich ist ein nicht für alle Parteien gangbarer Weg. Die Christlichen Demokraten zum Beispiel können hier nicht über ihren Schatten springen. Aber sie brauchen es auch nicht. Das deutsche Parteiensystem ist - grob dargestellt — um zwei Pole konstruiert. Der eine Pol entspricht dem Teil der Gesellschaft, der vorwiegend auf Sicherung und Bewahren des Erreichten fixiert ist. Diesen bewahrenden Teil deckt im wesentlichen die CDU ab.
Der andere Pol ist der unruhige Teil der Gesellschaft, jene nach mehr oder weniger Veränderung drängenden Kräfte. Dieses Spektrum fällt vorwiegend in die Zuständigkeit der SPD. Dazwischen pendelt die FDP, um je nach mehrheitlichem Trend in der Gesellschaft der einen oder anderen Gruppierung im Parlament zur Regierungsmehrheit zu verhelfen.
Dieses stark vereinfachte Modell ist nun durch das Auftreten der Grünen und Alternativen durcheinandergeraten. Die alleinige Mehrheitsbeschaffungs-funktion der FDP ist in Frage gestellt. Es gibt eine vierte Partei, die es fertigbringen kann, Mehrheiten zu verhindern.
Rechnet man die Grünen und Alternativen zu jenem unruhigen Teil der Gesellschaft, fällt der SPD die Aufgabe zu, sich mit dieser Konkurrenz, im „eigenen" Lager auseinanderzusetzen. Immerhin ziehen diese Gruppierungen vor allem der SPD Wähler ab. Diese Abtrünnigen zurückzugewinnen, bedeutet also gleichzeitig, den Grünen das Blut abzuzapfen, das man ihnen vorher unfreiwillig gespendet hat.
In der Zeit, als die SPD in Bonn noch Regierungspartei war, mußte ihr Bemühen um die grün/alternativen Randgruppen sie noch tiefer in den Widerspruch zwischen politisch Machbarem und programmatischem Wollen stürzen, jenen Widerspruch, der die tiefe Identitätskrise der SPD bewirkte.
Jetzt, wo die Sozialdemokraten wieder in der Opposition sitzen, der Exponent technokratischer Machbarkeit, Helmut Schmidt^ auf die Lotsenmütze verzichtet hat, kann sich die Partei den Integrationsbemühungen gegenüber den Grünen widmen, ohne ständig Verrenkungen in Sachen Glaubwürdigkeit vollführen zu müssen.
Das hat für die Stabilität des Parteiensystems langfristig nicht zu unterschätzende Bedeutung. Als Oppositionspartei kann die Sozialdemokratie durchaus ihren latenten Neigungen gegen die Kernenergie, gegen die Nachrüstung, für rigorose Umweltschutzmaßnahmen nachgehen.
Damit besetzt sie Themenbereiche, die sie bislang immer nur unter dem Gesichtspunkt anpacken konnte, ob sie auch nicht der Regierungsfähigkeit in Bonn schaden. Diese Hemmschwelle fällt weg. Zum zweiten verfügen die Sozialdemokraten mit Erhard Eppler und Oskar Lafontaine über ein personelles Angebot, das die Partei tatsächlich für potentielle Grün-Wähler wieder interessant macht.
Nun kann man mit Recht fragen, ob denn die SPD auf diesem Weg nicht Gefahr läuft, selbst zu einer Art alternativer Bewegung und damit ebenfalls zu einem Un-sicherheitsfaktor für das parlamentarisch-demokratische System zu werden. Das wäre sicher dann der Fall, wenn ein kompletter Austausch in der Mitgliedschaft und in der Wählerschaft der Sozialdemokratie stattfände. Das freilich ist kaum zu erwarten.
Zwar sind schon bisher der SPD eine Menge Mitglieder und Wähler davongelaufen, und zwar nicht nur ins grüne und alternative Umfeld, sondern auch ins konservative Lager. Dieser Trend wird sich auch in Zukunft noch fortsetzen, wenn die SPD ihre Arme für Grüne und Alternative öffnet. Doch diesem Vorgang ist ein Korrektiv immanent, nämlich die Zielvorgabe, wieder mehrheitsfähig zu werden.
Da weder grüne noch alternative Vorstellungen in der Bundesrepublik mehrheitsfähig sind — auch nicht in jenem unruhigen Teil der Gesellschaft — heißt das nicht mehr und nicht weniger, als daß die SPD sich zwar mit diesen Gruppierungen argumentativ auseinandersetzt, ihnen auch teilweise entgegenkommt, aber auf keinen Fall sich vollinhaltlich mit ihnen identifiziert.
Wahlpolitisch bedeutete das, daß die SPD zwar auf längere Sicht keine Mehrheit der Wähler hinter sich vereinigen kann, wohl aber stetig Fortschritte macht, wenn sie sich im demokratisch-parlamentarischen System weiterhin als stabilisierender Faktor präsentiert. Integration mit notwendigem Aufeinanderzugehen auf der einen, Attraktivität bewahren für auf Stabilität Wert legende Bürger auf der anderen Seite—das markiert den schwierigen Weg, den die SPD gehen muß.
Sie kann dabei darauf hoffen, daß von ihrem Ausscheiden aus der Bonner Regierung an, die Zeit für sie arbeitet.Beim Machtwechsel von der Union zur SPD/FDP-Koalition 1969 war dieser damals noch knappen Entscheidung der Wähler eine langsame, aber stetige Entwicklung vorausgegangen, die in breiten Teilen der Bevölkerung das Bedürfnis nach politischer Veränderung reifen ließ, nach Reform, nach einem Aufbruch erstarrter Strukturen.
Dem Machtwechsel jetzt ist die umgekehrte Entwicklung vorausgegangen. Nach der Reformeuphorie kam die Ernüchterung, dann das Unbehagen vor weiteren Experimenten und schließlich der dringende Wunsch, wenigstens das Erreichte zu bewahren. Das war die Stunde der Unionsparteien.
Die Deutschen müssen sich jetzt wohl darauf einrichten, daß eine längere Periode christlich-demokratischer Herrschaft angebrochen ist. Daran könnte nur der Fall etwas ändern, daß bei den Wahlen am 6. März statt der FDP die Grünen ins Parlament einziehen und eine Sperrminorität haben, die es keiner der anderen Parteien erlaubt, mit Mehrheit zu regieren.
Doch diese Gefahr ist geringer geworden, seit die SPD mit dem Verzicht von Helmut Schmidt für einen nicht geringen Teil des grünen Wählerpotentials wieder interessant geworden ist. Das bringt zwar der SPD keine Mehrheit, verhindert aber eine Sperrminorität der Grünen.
Die SPD hat eine verantwortungsvolle Aufgabe zu erfüllen: die politische und gesellschaftliche Integration derer, die voll Resignation oder Ingrimm dem Staat den Rücken kehren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!