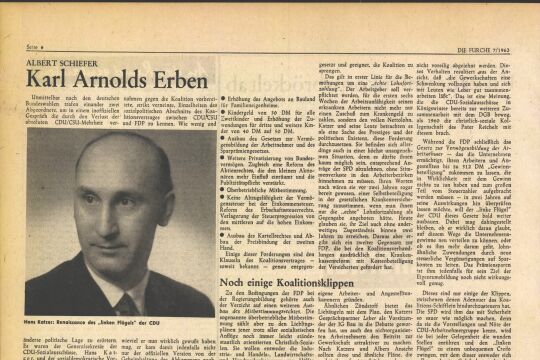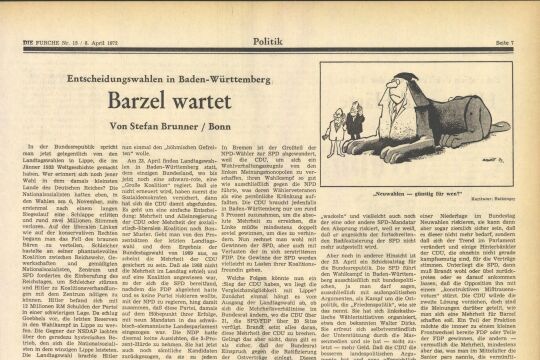Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine neue Epoche deutscher Politik
Die Analyse der Bundestagswahlen vom 6. März zeigt Verschiebungen in der Parteienlandschaft, die weit über den Tag hinaus das Bild der Bundesrepublik prägen werden.
Die Analyse der Bundestagswahlen vom 6. März zeigt Verschiebungen in der Parteienlandschaft, die weit über den Tag hinaus das Bild der Bundesrepublik prägen werden.
Der Wahlsieger Helmut Kohl und seine Unionsparteien können sich in einem nicht mehr für möglich gehaltenen Erfolg sonnen. Um ein Haar hätten CDU und CSU die absolute Mehrheit erreicht, was bisher nur Konrad Adenauer im Jahre 1957 gelungen ist.
Die 48,8 Prozent der Stimmen, das zweitbeste Ergebnis für die Union bisher, geben aber nicht das ganze Wählerpotential für die Christdemokraten wieder. Vielmehr ist in Rechnung zu stellen, daß eine erkleckliche Anzahl von Wählern, die eigentlich zum christdemokratischen Reservoir gezählt werden müßten, die entscheidende Zweitstimme der FDP gegeben haben. Die Gründe dafür sind vielfältig. s
Ein Teil mag sich deshalb so entschieden haben, weil er der CDU/CSU eine absolute Mehrheit und damit ein Regieren aus eigener Kraft nicht zutraute. Ganz weitsichtig Denkende dürften sich darüberhinaus gesagt haben.
daß eine absolute Mehrheit für die Union ein kaum wiederholbarer Glücksfall wäre und deshalb spätestens bei der nächsten Wahl wieder ein Koalitionspartner gebraucht würde. Wer anders als die FDP hätte das aber sein können? Fakten, die jetzt bestätigt würden, hielten länger.
Ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Teil der zur FDP gewechselten Unionswähler hat andere Gründe. Diesen, meist der sowohl gehalts- wie intelligenzmäßig höheren Schicht der Bevölkerung angehörenden Personen fehlt das endgültige Vertrauen in die wirtschaftspolitische Stetigkeit der Union. Sie hätten bei einer absoluten Mehrheit der Christdemokraten nicht sicher sein können, daß die innerparteilichen Druckverhältnisse eine marktwirtschaftliche und damit leistungsorientierte Politik in erwünschtem Maße zugelassen hätten.
Ein dritter, nicht zu unterschätzender Faktor für die FDP-Wähler war das wiedererstandene Gespenst Franz Josef Strauß. Obwohl die Zeit manche Wunden heilt, scheint es ihr nicht zu gelingen, ein Negativ-Image zu neutralisieren oder gar umzukehren. Strauß zieht immer noch, nämlich Wähler von der Union ab. Sie kamen diesmal bis auf einen nicht ins Gewicht fallenden Rest voll der FDP zugute, die sich im Wahlkampf mit der Parole, sie wolle und werde eine Rückkehr von FJS nach Bonn verhindern, weit, aber wirksam, aus dem Fenster gelehnt hatte.
Das Problem für die FDP ist nun freilich, diese Blutspende der Union auf Dauer im liberalen Kreislauf zu konservieren. Das kann sie nur dann, wenn sie auch künftig als Korrektiv an der Seite der Christdemokraten für notwendig erachtet wird.
In der Koalition mit der SPD spielte die FDP nach zwei Seiten die Regulierrolle. Nach rechts mit ihren wirtschaftspolitischen und in Otto Graf Lambsdorff hervorragend repräsentierten Grundsätzen den Bremser oder gar Verhinderer, nach links mit liberali-stischen Reformideen in der Innen- und Rechtspolitik.
Mit letzterem kann die FDP in der neuen Konstellation freilich ihre neuen Wähler nicht halten. Von freisinnigen Reformen hat man dort die Nase voll. Wohl aber könnte die FDP in bewährter Manier und sogar noch kompromißloser als in der alten Koalition nunmehr die wirtschafts- und ordnungspolitischen Prinzipien einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung verkörpern.
Dies bietet sich vor allem deshalb an, weil CDU und CSU ihrerseits Profilprobleme bekommen dürften. Ein erheblicher Teil der ihnen zugute gekommenen Stimmenzuwächse stammt nämlich von Arbeitnehmern, die ehemals zum eisernen Reservoir der SPD gehörten. Seit die Sozialdemokraten jedoch mit ihrem grün-roten Techtelmechtel gerade diese meist biederen Leute verprellen, die von der SPD alles mögliche, nur keine glaubhaften Rezepte zur Belebung der Wirtschaft und zum Abbau der Arbeitslosigkeit vernehmen, haben sie diesmal — auch wenn es schwer gefallen sein sollte — den Bruch vollzogen und den Hafen gewechselt.
Natürlich muß die Union nun darauf achten, dieses nicht unerhebliche Potential auf Dauer zu binden. Das kann sie aber nur, wenn sie inhaltlich nach links rückt. Das bedeutet in praxi, daß stärker als bisher das soziale, insbesondere von der Katholischen Soziallehre geprägte Element in die Politik Eingang findet. Dann aber wird für die FDP rechts von der Union der Platz frei, der einzig und allein ihr eine über den Tag - hinausgehende Stabilisierung garantieren kann.
Damit wäre aber auch eine langfristige Zementierung des christlich-liberalen Bündnisses möglich, da mit dem entsprechenden politischen Angebot ein Spektrum abgedeckt werden kann, das weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmacht.
Genau das wiederum verdüstert für die SPD alle Horizonte. Die Partei hat in zwei Richtungen verloren. Einmal an die Grünen, hier vor allem junge Wähler. Zum zweiten, und das geht ans Mark der Partei, sind die Arbeiter in Scharen davongelaufen.
Das Dilemma, in dem die Sozialdemokraten stecken, ist deshalb viel größer, als es das magere Wahlergebnis von 38,2 Prozent auszudrücken vermag. Auf diesem Stand war man zuletzt 1965. Das war knapp sechs Jahre nach dem hart umkämpften Friedensschluß einer ursprünglich klassenkämpferisch ausgerichteten Nachkriegs-SPD mit dem Bürgertum.
Heute nun beginnt dieser Friede brüchig zu werden. Noch immer steht die SPD fassungslos vor der Tatsache, daß die Grünen ihr am linken Rand das Wählerwasser abgraben. Zwar hatte man gehofft, durch das Ausscheiden aus der Regierungsverantwortung im letzten Oktober für das Protestwählerpotential wieder attraktiv zu werden. Aber diese Hoffnung trug nur kurz. Einen harten, aber ausreichend großen Kern von knapp über fünf Prozent Grün-Wähler hat man nicht herüberziehen können.
Für die SPD stellt sich nun die entscheidende Frage, wie sie die Zukunft meistern kann. Zwei Wege bieten sich an.
Die SPD kann sich auf ihre alten Traditionen besinnen und in einem erneuerten und mit frischem Inhalt ausgefüllten Bündnis mit den Gewerkschaften dort beginnen, wo sie bereits 1965 stand und vier Jahre später mehrheitsfähig geworden war.
Dieser Weg freilich scheint schon verbaut zu sein. Denn die Personen, die die SPD in dieser
Richtung führen könnten, sind nicht mehr vorhanden oder treten in absehbarer Zeit ab. Dafür haben diejenigen in der Sozialdemokratie das Sagen, die mit dem ne-bulosen Hinweis, die Jugend sei die SPD von morgen, die Partei immer stärker linken und grünen Kräften öffnen wollen.
Nun muß dieser Weg nicht falsch sein. Im Gegenteil, unter staatspolitischen Gesichtspunkten ist er sogar notwendig.
Wenn die Bundesrepublik nicht Gefahr laufen will, auf längere Sicht mit einem immer militanter werdenden Protestpotential sich herumschlagen zu müssen, bleibt nur die Möglichkeit, diese Kräfte wieder in das etablierte System zu integrieren. Die Grünen, selbst Teil der Protestbewegung, können diese Aufgabe nicht erfüllen, da sie ihre Lebensgrundlage beseitigen würden. Wer aber sonst als die SPD könnte es dann?
Die Konsequenz allerdings ist für die Sozialdemokraten erst einmal niederschmetternd. Bis man die nach einer breiten Öffnung in die Partei einströmenden Protestkräfte grüner oder alternativer Provenienz verkraftet hat, bis man sich daraufhin eine neue Identität geschaffen hat, die für breite Schichten akzeptabel sein muß, ist man nicht wieder regierungsfähig.
Mit anderen Worten: Die SPD bleibt solange in der Opposition, bis das Werk der Integration vollbracht und eine Öffnung hin zur Mitte wieder möglich wird. Herbert Wehner, der große alte Mann der SPD, spricht von 15 Jahren. Er mag recht behalten. Aber dann ist spätestens wieder ein Wechsel fällig.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!