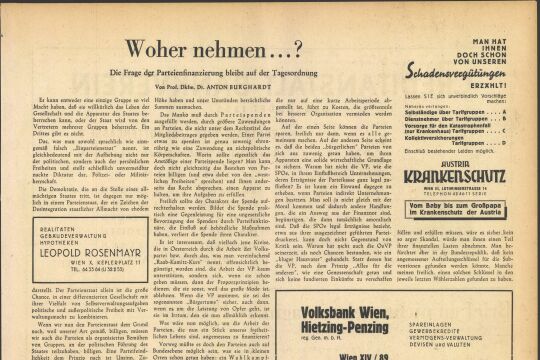Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wahlreform und Zweiparteiensystem
Der Hebel, mit dem ein solcher Umbau durchgeführt werden kann, ist die Abkehr vom Prinzip der Verhältniswahl. Es kann als unbestrittene Tatsache angesehen werden, daß die relative Mehrheitswahl zu einem reinen Zweiparteiensystem führen würde, daß also immer eine Partei im Besitz einer regierungsfähigen Mehrheit wäre. Das im Art. 26 B-VG verankerte Verhältniswahlsystem, dem die Idee zugrunde liegt, die politische Einstellung der Bevölkerung müßte sich, proportional verkleinert, in der Zusammensetzung des Parlaments spiegeln, ist die Hauptursache dafür, daß eine Partei nur ausnahmsweise im Parlament die absolute Mehrheit erringt.
Die „spiegelbildliche Gerechtigkeit“ der Verhältniswahl hat sich schon lange als Illusion herausgestellt. Die Verhältniswahl hat, begünstigt durch die unabhängig von ihr wachsende Macht und Bedeutung der Parteien und der Parteizentralen, dazu geführt, daß die Gegensätze zwischen den Parteien überbewertet, die Gegensätze und der Pluralismus innerhalb der Parteien aber unterbewertet erscheinen. Die Forderung, ein Wahlsystem müßte im Sinn einer Spiegelbildlichkeit „gerecht“ sein, mißversteht auch die Funktion einer demokratischen Wahl, die ein dynamischer Integrationsprozeß ist, die eine unüberschaubare Vielheit politischer Interessen und Meinungen auf eine überschaubare Zahl reduzieren und zu politisch entscheidungsfähigen Institutionen integrieren soll.
Ein Übergang vom Prinzip der Verhältniswahl zum Prinzip der relativen Mehrheitswahl nach britischem Vorbild würde in Österreich ein Zweiparteiensystem installieren, das wir jetzt, seit 1966, als Ausnahmeerscheinung in Ansätzen und probeweise vorexerziert bekommen. Ein auf der relativen Mehrheitswahl beruhendes Zweiparteiensystem würde, im Gegensatz zum gegenwärtigen, wegen des Art. 26 B-VG nur ansatzweise vorhandenen Zweiparteiensystem, dem Wähler zwei klare Fragen stellen: Bist du für eine öVP-Regierung, die von einem bestimmten Team unter der Führung eines bestimmten Politikers gebildet werden soll, oder bist du für ein SPÖ-Regierungsteam und einen SPÖ-Kanzler? Die Stimmabgabe für eine der beiden Parteien schließt eine Stimmabgabe für eine bestimmte Regierung mit ein.
Diese klare Fragestellung an die Wählerschaft ist bei Verhältniswahl grundsätzlich nicht möglich. Der Wähler einer österreichischen Groß partei wird 1970 wahrscheinlich nur sehr bedingt darauf Einfluß haben, ob er seine Stimme für die Alleinregierung seiner Partei in die Waagschale wirft, oder ob er für eine große oder gar für eine kleine Koalition votiert. Bis zur Nationalratswahl 1962 wußte ein solcher Wähler sehr wohl, für welche Regierung er votiert — beide Großparteien hatten sich immer schon vor der Wahl auf eine, große Koalition festgelegt. Es fehlte dem Wähler aber an realistischen Alternativen, er konnte mit seiner Stimme nur dazu beitragen, die Gewichte innerhalb der a priori feststehenden Regierungsmehrheit zu verschieben. Zur Zelt der großen Koalition waren die Wähler der Großparteien de facto dazu verurteilt, auch für die Koalitionsregierung zu stimmen. Seit 1966 hat nun eine Entwicklung eingesetzt, die zum Gegenteil führen könnte — daß der Wähler überhaupt nicht mehr weiß, für welche Regierung er votiert. Es ist einer der größten Vorteile eines durch die relative Mehrheitswahl garantierten Zweiparteiensystems, daß die Meinung des Wählers nicht nur über die Zusammensetzung des Parlaments, sondern auch über die Zusammensetzung und die politische Ausrichtung der Regierung, des eigentlichen Motors der Politik, klar zum Ausdruck kommt. „Die reine relative Mehrheitswahl bringt die Stellungnahme des Wählers zum Regierungskurs am klarsten zur Geltung... für den Wähler (ist) die Wahl zwischen Bewerbern der beiden Parteien meist gleichbedeutend mit der Wahl zwischen zwei Regierungen.“ (Helmut Unkelbach.)
Neben diesen Vorteil des Zweiparteiensystems, den „direkten Kontakt“ zwischen Regierung und Wählern, tritt als weiterer Vorzug die erhöhte Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit einer Einparteienregierung in demokratischen „Normalzeiten“. Es war die Ursache des allgemeinen Unbehagens mit der Koalition, daß die beiden Koalitionspartner einander blockierten, daß es kaum mehr zu Entscheidungen auf dem (an sich idealen) Kompromißweg kam, sondern bestenfalls zur Entscheidung durch Junktimierung, nach dem Grundsatz „do ut des“, in sehr vielen Fällen aber zur Nicht-entscheidung.
Der wichtigste Vorzug der relativen Mehrheitswahl ist es aber, daß die relative Mehrheitswahl in den
Krisenzeiten eine erhöhte Stabilität der Demokratie, einen erhöhten Schutz gegenüber antidemokratischen Extremisten der Linken und der Rechten bietet. In demokratischen „Normalzeiten“ ist man nur allzugerne bereit, diesen Gesichtspunkt zu mißachten. Verschiedene Anzeichen einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und der Formierung neuer (altbekannter) Lager (NDP) erinnern aber daran, daß die Demokratie gerade in Schönwetterzeiten für Schutz zu sorgen hat, um gegen die am politischen Horizont aufziehenden Gewitter, die niemals ausgeschlossen werden können, gewappnet zu sein. Die relative Mehrheitswahl vermindert die Aussichten der extremistischen Außenseiter auf eine legale Absprungbasiis in parlamentarischen Gremien in einem entscheidenden Umfang, da ja de facto nur die beiden Großparteien reelle Chancen auf eine Vertretung im Parlament haben. Diese Chan-cenlosigkeit der extremistischen Flügelparteien beeinflußt aber auch das Wählerverhalten potentiell extremistischer Wähler, die bestrebt sind, ihre Stimme nicht für chancenlose Kandidaten zu verschwenden.
Die relative Mehrheitswahl begünstigt aber nicht nur die Großparteien gegenüber kleinen, extremistischen Parteien, wichtig ist auch, daß sie auf die Großparteien einen Zwang zur Mäßigung ausübt. Wenn nur zwei Parteien im demokratischen Konkurrenzkampf um die Gunst der Wähler sind, entscheiden über den Ausgang der Wahl die Wähler, die zwischen den Großparteien stehen, die ihre Stimme sowohl der demokratischen Rechtspartei als auch der demokratischen Linkspartei geben könnten. Die Parteien werden so gezwungen, sich an der demokratischen Mitte zu orientieren. Während bei einer durch das Verhältniswahlsystem nie auszuschließenden, in einer Krisensituation wahrscheinlichen Parteienzersplitterung häufig Außenseiter eine Schiedsrichterrolle zugeteilt bekommen, fällt diese Schiedsrichterrolle bei einem Zweiparteiensystem der demokratischen Mitte zu.
Die Abhängigkeit der Parteien von der demokratischen Mitte verhindert auch, daß die Parteien einseitig profiliert werden. Weder würde die ÖVP eine reine Land- und Kleinstadtpartei werden, noch die SPÖ ausschließlich eine Großstadtpartei. Die zentripetale Konkurrenzform im Zweiparteiensystem verhindert, daß die Parteien solche einseitigen Profile annehmen, die Parteien sind vielmehr gezwungen, sich mehr als bisher an ihre potentiellen Wähler anzupassen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!