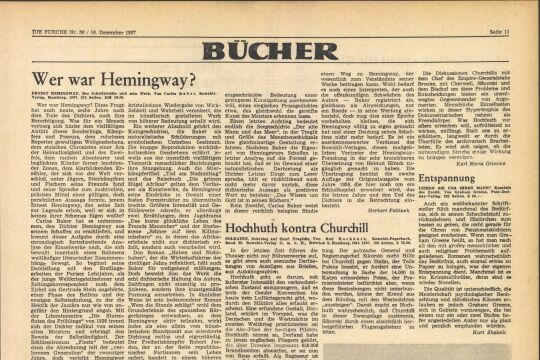Ein Nachruf auf Rolf Hochhuth
Mit Dramen wie „Der Stellvertreter“ wurde er berühmt – als Vertreter des dokumentarischen Theaters und unerbittlicher literarischer Ankläger. Ein Nachruf auf Rolf Hochhuth, der am 13. Mai 89-jährig verstorben ist.
Mit Dramen wie „Der Stellvertreter“ wurde er berühmt – als Vertreter des dokumentarischen Theaters und unerbittlicher literarischer Ankläger. Ein Nachruf auf Rolf Hochhuth, der am 13. Mai 89-jährig verstorben ist.
Als Theaterautor müsse er es wagen, „ganz altmodisch zu empfinden“, schrieb Rolf Hochhuth im Jahr 1963, als er Fragen der Zeitschrift Theater heute beantwortete zum Thema: „Soll das Theater die heutige Welt darstellen?“ Er stellte sich bewusst gegen den herrschenden Geist der Zeit, der Geschichte nicht als menschengemacht wahrhaben wollte, sondern davon ausging, dass „anonyme Instanzen“ dahinterstünden.Die Ansicht, dass Männer Geschichte machten, galt als verpönt.
Diese Haltung von „Modephilosophen“ – darunter fiel für ihn auch ein so prominenter analytisch-kritischer Geist wie Theodor W. Adorno – spiele Kriegsverbrechern in die Hände, sie sprächen Täter „also frei von ihren Verbrechen“, so Hochhuth. Sein ganzes Schriftstellerleben lang lehnte sich Hochhuth dagegen auf und nutzte bevorzugt die Theaterbühne, um Opfern zumindest späte Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, indem er Täter in Maßanzug und Talar beim Namen nannte.
Theater bedeutete für ihn ganz im Sinne von Schiller eine moralische Anstalt, wo Konflikte verhandelt werden, die die Machtverhältnisse einer Gesellschaft betreffen: „wo das Humane, auch in reduzierter Form, nichts mehr zu suchen hat, hat auch das Theater sein Recht verloren“. Für die Form bedeutet das, dass der Autor Figuren auf die Bühne stellen muss, die gezwungen werden, Entscheidungen zu treffen, „denn wo er (der Mensch, Anm.) nichts mehr entscheiden kann, da ist kein Drama, die Erschlagung einer Personengruppe durch eine Lawine ist keine dramatische Konstellation, sowenig wie die Erschlagung durch eine Fliegerbombe“.

Liebe Leserin, lieber Leser!
Gerade in Zeiten wie diesen freuen wir uns über jede Unterstützung. Denn Qualitätsjournalismus kostet Geld. Testen Sie uns im Rahmen eines kostenlosen Probe-Abos – oder helfen Sie durch eine Spende mit, die Zukunft der FURCHE zu sichern. Näheres unter www.furche.at/abo.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger-Fleckl (Chefredakteurin)
Gerade in Zeiten wie diesen freuen wir uns über jede Unterstützung. Denn Qualitätsjournalismus kostet Geld. Testen Sie uns im Rahmen eines kostenlosen Probe-Abos – oder helfen Sie durch eine Spende mit, die Zukunft der FURCHE zu sichern. Näheres unter www.furche.at/abo.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger-Fleckl (Chefredakteurin)
Schuld und Verantwortung
Hochhuth war unerbittlich und fordernd. Als öffentliche Person nutzte er seine Prominenz, um Rechte einzuklagen. In einer Rede vor der Paulskirche im März 1970, die sich heute erschreckend aktuell liest, griff er scharf die USA als Verbündete der Bundesrepublik in der NATO an, die Luftangriffe auf zivile Ziele rechtfertigten: „Wer einen Wehrlosen, Zivilisten oder Gefangenen auf der Erde totmacht, wird strafbar, wer hundert Wehrlose aus der Luft verbrennt, wird dekoriert.“ Der deutsche NATO-General Wolf von Baudissin sprach von Zivilisten als den „lohnenderen Zielen“.
Es ist nicht schwer zu verstehen, dass sich Hochhuth in der deutschen Politik zahlreiche Feinde machte. Ludwig Erhard diffamierte 1965 Literaten vom Schlage Hochhuths und Günter Grass’ als Banausen und Pinscher. Die deutschen Politiker als Helden des Wirtschaftswunders konnten Kritik schwer aushalten.
Theater bedeutete für Hochhuth ganz im Sinne von Schiller eine moralische Anstalt, wo Konflikte verhandelt werden.
Schlagartig bekannt, ach was: berühmt, wurde Hochhuth mit seinem Drama „Der Stellvertreter“, uraufgeführt 1963 in Berlin durch die Freie Volksbühne in der Regie von Erwin Piscator. Daraus entwickelte sich ein handfester Skandal, wurde doch Papst Pius XII. bezichtigt, vom Holocaust gewusst und dennoch geschwiegen zu haben. Damit erfuhr das dokumentarische Theater, dem Hochhuth fortan treu bleiben sollte, einen ungeheuren Aufschwung.
Er nahm in Kauf, künstlerischen Mehrwert zugunsten der Faktentreue hintanzustellen, indem er reichlich Quellenmaterial einbaute. Das sollte seine Stücke weniger angreifbar machen, weil die Beweise in den Dokumenten gleich mitgeliefert wurden. Mit „Der Stellvertreter“ fing alles an. Dem Papst, zögernd und entscheidungsarm, wird der Jesuitenpater Fontana gegenübergestellt, der sich dazu entschließt, gemeinsam mit Juden ins KZ zu gehen. Die Diskussion wurde international ausgetragen und hält bis heute an. Wie mit Pius zu verfahren ist, ob er Mitwisser und also schuldig sei, ist nicht entschieden. Überhaupt trat Hochhuth bevorzugt als Ankläger in Erscheinung.
Vier Jahre später erregte er mit dem Stück „Soldaten“ Aufsehen, in dem er Winston Churchill literarisch den Prozess machte. Dabei hatte man sich darauf geeinigt, diesen als einen der „Guten“ in der Weltgeschichte anzunehmen. Dem britischen Premier wird der Befehl zur Bombardierung deutscher Städte angelastet. Damit mache er sich des Völkermordes im Zweiten Weltkrieg schuldig. Das Thema Schuld und Verantwortung, der rote Faden im Werk Hochhuths, wird unter anderen historischen und politischen Voraussetzungen neu diskutiert. Bei seinen Recherchen verließ er sich auf Arbeiten des britischen Historikers David Irving. Dass er diesen noch 2005, als dessen geschichtsrevisionistische Haltung längst bekannt war, verteidigte, machte ihn in Deutschland vorübergehend zur Unperson.
Ein Hochhuth-Stück ist kalkulierter Konfliktstoff, dazu in die Welt gesetzt, um Bruchlinien in der Gesellschaft sichtbar zu machen.
Wie einflussreich die Literatur Hochhuths war, erwies sich am Beispiel des Dramas „Juristen“ von 1979. In dieser politisch aufgeheizten Zeit sollte der „Radikalenerlass“ Verfassungsfeinden den Zugang zu öffentlichen Ämtern unmöglich machen. Einem jungen Assistenzarzt droht das Ende seiner beruflichen Karriere in einem Krankenhaus. Ihm wird ein Minister gegenübergestellt, der nach dem Krieg rasch nach ganz oben gelangt, obwohl er als Kriegsrichter im Dritten Reich zahlreiche Todesurteile fällte.
Brisant war das Stück deshalb, weil nicht die mangelnde historische Aufarbeitung allein angeprangert wurde, als Zielscheibe diente der badenwürttembergische Ministerpräsident Hans Filbinger, dem keine andere Wahl als der Rücktritt von seinem öffentlichen Amt blieb. Kalkulierter Konfliktstoff Hochhuth zog eine Lehre aus der Geschichte, die ihm den optimistischen Glauben an eine friedliche Zukunft raubte. In seinen „Vorstudien zu einer Ethologie der Geschichte“ widersetzte er sich dem Fortschrittsgedanken von Hegel bis Marcuse, wonach wir uns auf dem Weg in lichte Höhen befänden.
Wo Hochhuth auch immer hinsah, Elend, Mühsal und Hinterhältigkeit der Menschen gerieten in sein Blickfeld. Wenn er sich nicht mit Zeitgeschichte beschäftigte, setzte er sich mit der Gegenwart oder einer uns blühenden sehr nahen Zukunft auseinander. „McKinsey kommt“ (2004) geriet schon im Vorfeld der Uraufführung zu einem Skandal, weil manche herauszulesen meinten, dass zum Mord am Chef der Deutschen Bank aufgerufen würde. Das war natürlich Unsinn. Deutlicher zu sehen war allerdings, dass sich der Autor übernommen hatte, komplexe wirtschaftliche Verhältnisse bühnentauglich umzusetzen.
So ist etwas sehr Einfaches und Plakatives herausgekommen. Arbeiter und Angestellte werden entlassen, der Kapitalismus triumphiert, ein Aufstand kippt das System, ein für Hochhuth ungewöhnlich versöhnliches Ende. Hochhuth hat Recht, die Empörung über grassierende Menschenverachtung ist angebracht, gelungen ist das Stück dennoch nicht. Es wird gar sehr auf Effekte gesetzt. Hochhuth legte sein Schreiben an, um Kontroversen zu entfachen. Der Zweck eines Dramas war erfüllt, wenn es direkt in die Diskussionskultur einer Gesellschaft eingriff.
Über Hochhuth zu schreiben, heißt mehr als bei anderen Autorinnen und Autoren immer auch, die Wirkungsgeschichte mitzudenken. Ein Hochhuth-Stück ist kalkulierter Konfliktstoff, dazu in die Welt gesetzt, um Bruchlinien in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Das macht seine Literatur zu etwas Besonderem, auch wenn das Räderwerk der Dramaturgie gehörig knirscht. Hochhuth bewegte etwas, das ist sehr viel.
Der Autor ist Literaturkritiker.