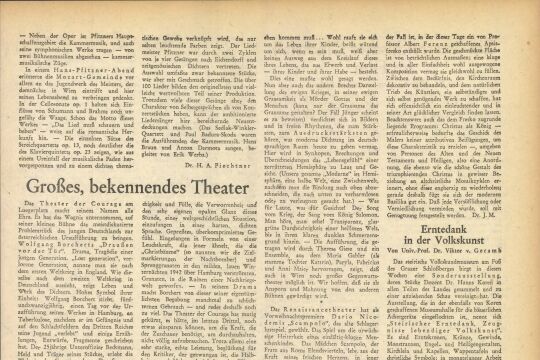Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Emanzipation durch Aphrodite
In der Ägäis gibt es zweitausend Inseln, von denen nur 130 bewohnt sind. Auf vielen von ihnen war ständiger Friede, so daß man sie schon in der Antike als „Inseln der Glückseligen“ bezeichnete. Auf einer, die nicht einmal im Atlas verzeichnet ist, spielt die Komödie „Lysistrate“ von Rudolf Hochhuth, die im Volks-theater — am gleichen Abend wie in Essen — zur Uraufführung gelangte.
Die Handlung des gleichnamigen Lustspiels von Aristophanes wird da in die Gegenwart verlegt. Es geht aber nicht darum, die Beendigung eines Kriegs zu erzwingen, sondern zu verhindern, daß Athen auf dieser Insel einen Kriegshafen und einen Atomwaffenstützpunkt für die USA errichtet, denn das hieße im Kriegsfall: verbrannte Erde, verbrannte Menschen. Die fünf Großbauern der iiisei sind bereit, ihr Land dem Staat zu verkaufen. Um dies zu hintertreiben, hat die Tochter des Wirts, die Abgeordnete Dr. Lysistrate Soulidis, eine Witwe, den Widerstand der Frauen organisiert. Sie treten in Ehestreik, ziehen in den Gasthof, die Männer müssen nun auf den Feldern doppelt schuften.
Worum geht es Hochhuth? Um die Entmachtung des immer wieder zerstörerisch wirkenden Mannes, um das Mündigwerden der Frauen durch sexuelle Emanzipation. Eine Aphroditenstatue wurde von dem kleinen Trupp griechischen Militärs, der die Untersuchungen wegen des geplanten Stützpunkts führt, im Meer gefunden. Angeblicher Wink des Olymp, wer auf der Insel herrschen soll: Aphrodite. Auf Anstiften Lysi-strates — Schritt über Aristophanes hinaus — schlafen die Frauen mit den griechischen Offizieren, um die Rachsucht ihrer Männer so sehr aufzuputschen, daß sie die „Verführer“ zwingen, die Insel für militärische Zwecke ungeeignet zu erklären und zu verschwinden.
Der Text hat mit sehr langen Schauplatzangaben und zwischengeschalteten Erläuterungen eine Länge von 176 Druckseiten, das Stück ufert aus. Da es Hochhuth lediglich darauf ankommt, den Aufstand der Frauen zu zeigen, gibt es in diesem völlig naturalistischen Stück kein Gegenspiel, es packt nicht, die Gestalten bleiben einem völlig gleichgültig. Die sehr scharfe Raffung der Wiedergabe unter der Regie von Peter Lotschak auf eine Spielzeit von nur wenig mehr als zwei Stunden, verbessert das nicht. Was Farbe gibt, fällt nun weg, das Keltern der Trauben durch die Bäuerinnen, die Badstubenatmosphäre. Der Schluß wird willkürlich geändert, das Militär tritt auf der Insel die Herrschaft an.
Es ist auch gänzlich falsch, das szenische Geschehen auf einen kleinen, in der Mitte der Bühne errichteten, zwar gut aussehenden Aufbau von Heinz Ludwig einzuengen, statt naturalistisch gestaltete Räume zu bieten. So gibt es reichlich Unstimmigkeiten in der Umsetzung der Vorgänge. Barbara Petritsch glaubt man nicht recht die Persönlichkeitskraft der Abgeordneten Lysistrate, Peter Hey zeichnet einen korrupten Minister ohne stärkere Charakterisierung, Uwe Falkenbach hingegen übersteigert einen griechischen Oberst zur Karikatur. *
Im Theater in der Josefstadt führte das Schweizer Tourneetheater an drei Abenden das Drama „Des Teufels General“ von Carl Zucfc-mayer vor, das Wir seit 25 Jahren nicht mehr gesehen haben. Wie wirkt es heute? Ein Mensch, leidenschaftlich seinen außerordentlichen beruflichen Fähigkeiten verhaftet, dient einem verbrecherischen System, obwohl er es verachtet, er dient ihm, weil es besondere Entfaltungsmöglichkeiten bietet und lädt damit Schuld auf sich. Das ist das Problem des deutschen Fliegergenerals Harras im Zweiten Weltkrieg. Selbsterkenntnis der Schuld? Er wählt den Tod, da er als Regimegegner von der ihn verfolgenden Gestapo nur Liquidierung zu erwarten hätte. Das ist ein individuelles Schicksal, das in vermindertem Ausmaß die Schuld auch jener bloßlegt, die dagegen waren und doch in ihren Stellungen verblieben. Was sagt das aber heute jenen Generationen, die diese Zeit nicht miterlebten? Das Stück bietet mit meisterhaft gezeichneten Gestalten einen präzisen Einblick in eine Kriegsmaschinerie, die — das mag man bedenken — in einem Großteil der heutigen Welt kaum anders organisiert ist. Unter der Regie von Horst Gnekow bot Hans-Joachim Kulen-kampff als General Harras eine völlig deckende Darstellung dieses vitalen, gelassen überlegenen Generals.
Eine Kleinbühne, das Ateliertheater, führt nun schon ein viertes Bühnenwerk von oder nach Carl Sternheim auf: „Die Hose.“ Man weiß, es geht um dieses intime Kleidungsstück, das Frau Maske auf der Straße entglitt, es geht um den Gatten Theobald, den Spießer, der in seiner Vitalität und Beschränktheit über einen Intellektuellen und einen Hypochonder, die, begehrlich geworden, seine Ehe bedrohen, siegt. Exer-zierhofatmosphäre männlicher Ehetyrannei bei Theobald als abschrek-kendes Beispiel, Anprangerung an-paßender Herrenmoral bei dem Intellektuellen. Das waren die Schießscheiben Klarsichtiger von einst. Heute würde man wohl die materiell gerichtete Gier, die den Spießer unserer Zeit kennzeichnet, einsetzen. Problem der Aufführung: Sternheims artiftzieller Stakkatostil. Die Regisseure Georg Rober und Peter Janisch überdrehen die Darstellung etwas, allerdings gelingt dies nicht einhellig, sie setzen überdies während des Spiels Cäsuren mit Wagner-Musik ein. Karl Dobravsky und Jutta Heinz als Ehepaar Maske und Karina Willam als altjünger-liche Nachbarin erweisen verschieden gerichtete Begabung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!