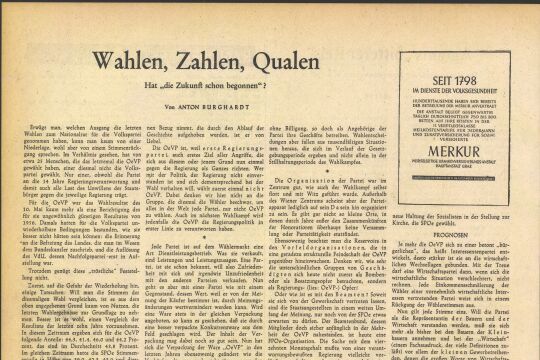Es war damals, als es noch die österreichische Koalition gegeben hat, in der Ära, die dann von der politischen Publizistik die Ära der „Reformer in der ÖVP“ genannt worden ist, als ein Ministerkollege der SPÖ-Fraktion etwa folgendes zu mir sagte: „Glauben Sie nioiit, daß mir die derzeitige mäßige V-rfas-sunc Ihrer Partei eine reine Freude bereitet; eine schwächliche ÖVP nützt dem Staat nichts, und sie schadet in gewisser Hinsicht der SPÖ, wenn sich unsere Partei bei der Schwäche des Gegners Lässigkeiten gestattet.“ Mein Gesprächspartner war berechtigt, so zu reden; niciht nur deswegen, weil er klug war, sondern vor allem deswegen, weil er etwas von der Fairneß an sich hatte, die zu den Eigenschaften eines Politikers gehören sollte.
Jedenfalls steckte in der Äußerung mehr als die geheime Angst eines „Koalitiomspolitikens“, der um die Haltbarkeit der eingewöhnten Regierungskoalition zittert. Das Gespräch entsprach übrigens einer Grundregel der politischen Taktik in der Demokratie: So Wie in der militärischen Taktik gilt auch in der Politik der Satz, wonach der Gegner jeweils so stark auftreten kann, wie es die eigenen Kräfte wegen ihrer Unterlegenheit gestatten müssen oder aus Ungeschicklichkeit und Lässigkeit mehr oder weniger freiwillig gesitaitten. In den Spätkriisen der jetzt schon legen-cüäiren österreichischen Koalition ist zweifellos die letztere Version sowohl bei der ÖVP als auch bei der SPÖ immer häufiger zugetroffen; daher kam auch zum Teil jene Unansehnlichkeat, die dem System bei seinem Untergang angehaftet hat. Ist dieser lässige und wenig kämpferische Stil aber nur eine Konsequenz des lauen Koalitions-klimas gewesen oder hat es da ge= wisse Zwangsläufigkeiten gegeben?
Der Preis des Appeasements
Die Fehler des früheren Ko-alitionissystems sind heute mehr oder weniger bekannt; sie sind zunächst ein Grundbestand des Good-will, der dem nachfolgenden Regierungssystem in der Anlaufzeit zugute kommt, so wie das immer bei einem Systemiweöhisel der Fall ist. Indes bleibt es das dauernde Verdienst des früheren Systems, daß es eine haltbare Verbindung zwischen der Staatsgewalt und den „Untertanen“ und zwischen der Regierung und den Regierten (wie man früher zu sagen pflegte) angebahnt hat, die vorher jedem Regime, das in Österreich zwischen dem 12. November 1918 und dem 11. März 1938 bestanden hat, in großen Teilen der Bevölkerung abgegangen ist.
Nach dem Blut, das einmal im Kampf um Österreich auf beiden Seiten vergossen worden ist, bedurfte es auf beiden Seiten sehr entschiedener Anstrengungen, um zuerst einmal gewisse „konforme Elemente“ für eine gemeinsame Ausübung der Regierungsgewalt hervorzubringen; es hat auf beiden Seiten große Überwindungen gekostet, da und dort Grundsätze, die für unerschütterlich gegolten haben, abzuändern oder aufzugeben, damit das übereinstimmende Verhatten möglichst vieler Staatsbürger (das für den Ablauf der öffentlichen Verwaltung und für das Gemeinwohl notwendig war) mit nunmehr friedlichen Mitteln (sicherzustellen. In Österreich ist das möglich gewesen; in anderen Ländern ist es dazu (trotz ähnlicher Verhältnisse unter einem Besatzungsregime) nicht gekommen.
Keine Arena
Aber die Harmonisierung der Bevölkerung hat nicht nur das Ensemble des Regimes harmonisiert, sondern Strukturvertsch iedenhe rten der Parteien oberflächlich verwischt. Wenn Kompromisse, die notwendig gewesen sind, in Fragen zustande kamen, die ihrer Natur nach für Kompromisse geeignet gewesen sind, dann wird man dagegen auch nachträglich nichts ein-= wenden. In ihrer guten Zeit ist die österreichische Koalition keine Arena für Kampfhähne gewesen; Männer wie Figl und Schärf, Raab und Helmer hatten für Typen, die aus Freude am Kampf den friedlichen Ausgleich immer ablehnen (selbst dann, wenn das umkämpfte Ziel ohnehin nicht erreichbar ist), nichts übrig. Es gab da ein stillschweigend gehandhabtes Kriterium: Wieviel können wir den „anderen“ zumuten, ohne daß beide Partner das Gesicht verliere.
Ein einziger Haufen um Langeweile
Es gab auch andere Typen; für die waren die grundsätzlichen Unterschiede zwischen christlichen Demokraten und demokratischen Sozialisten mehr von polemischer als von grundsätzlicher Bedeutung. Es sind Unterschiede, die keinen Ewigkeitswert besitzen, die aber nicht einfach durch eine sogenannte „Entideologisierung“ relativiert werden können, ohne daß zuletzt nur noch das übrigbleibt, was die Amerikaner „the preserva-tion of the two-pairty-system“ bezeichnen, und letzten Endes: die Konfusion aller in einem „einzigen großen feindlichen Haufen von Langeweile“.
Ein neuer Stil
Die „Reform“, die hüben und drüben unausbleiblich wurde, kam nicht nur deswegen, weil den zornigen Männern (die hierzulande gar nicht so jung gewesen sind) der Kragen geplatzt ist, nachdem sie den Koalitionsstil endlich satt hatten; über den Ozean kam anfangs der sechziger Jahre ein neuer Stil des Politischen zu uns.
Kennedy hat den Politikern der fünfziger Jahre vorgeworfen, sie hätten lang genug die „Bequemlichkeiten“ (!) einer „Überzeugung“ genossen und sich der Unbequemlichkeit entzogen, mit der Zeit neu zu denken. Solche Formulierungen sind den Jungen unter die Haut gegangen; sie sind an sich nicht geneigt gewesen, die „Meinungen“ der Alten unbeschaut und kritiklos zu übernehmen. Jetzt wurde ihnen außerdem gesagt, daß es sich bei diesen Meinungen ohnehin nur um „hartnäckige, unrealistische, bequeme Mythen“ handelt, um gefährliche Illusionen.
„Worum es geht“, erklärte Kennedy 1962, „ist keine grandiose Schlacht rivalisierender Ideologien..., sondern das praktische Management einer modernen Wirtschaft ..., eine grundsätzliche Diskussion der komplexen technischen Probleme, die es zu lösen gilt, um einen riesigen Wirtsebaftsapparat in Bewegung zu halten.“ So oder anders lauten jetzt die Formeln, die junge Menschen in den Verbindungen des CV ebenso akzeptieren wie ihre Kollegen im BSA. Die Formel der österreichischen Koalition: Zuerst die Wirtschaft und die soziale Sicherheit, paßt ziemlich genau auf das Clearing-System des neuen politischen Stils.
Milieukonform in neuer Sachlichkeit
Unversehens kommt ein Fehler in den neuen Denkvorgang: Die neue Methode des Politischen wurde mehr und mehr mit dem Sachinhalt verwechselt; die Brillanz der Methode wurde Kriterium der Leistung. Gefragt sind in allen Massenorganisationen die enrtideolo-giBäerten Fachmänner der Rationalisierung. Es sind Menschen, deren Haltepunkt im Gelände des Politischen weder ein religiöser Glauben, noch eine Weltanschauung (geschweige eine Ideologie) sein kann, und schon gar nicht das, was man neuerdings die „Parteiwahrheit“ nennt.
In dem neuen Kombinat Wissenschaft-Politik spielt zuletzt auf der politischen Rechten und auf der Linken die Hoffnung eine Rolle, daß es den social sciences gelingen muß,, einmal eine „generelle Theorie vom menschlichen Verhalten“ zu ergründen (George Caspar Homans), die auf die Gesellschaft genauso anwendbar sein soll, wie jede andere allgemein-wissenschaftliche Theorie (zum Beispiel die der Thermodynamik) auf die Daten ihres Geltungsbereiches.
Das neue Modell der Partei
So betrachtet, sind bereite alle politischen Parteien, die nach dem Modell 1945 strukturiert sind, überholt. Gefragt sind nicht die Parteiprogramme, sondern Aktionsprogramme nach der neuen Modellformel, die etwa lautet: Wissenschaftlich fundierte Sachlichkeit + Wirtschaftlichkeit + Image. Nachdem Kennedy 1960 seinen Gegenkandidaten Nixon in den großen Fernsehdiskussionen mit den Methoden der Tele-kratie erfolgreich bekämpfen konnte, hat die ganze politische Publizistik begonnen, in erster Linie darauf zu reflektieren, wie Kennedy (oder ein anderer Verfechter dieses Stils) etwas getan hat, und weniger, was getan worden ist. Das Zeitalter der telegenen Politik ist da.
Der AuiStromarxismus und die geschichtlich gewordene Sozialdemokratie wären nicht telegen gewesen; das charakterisiert ihre historischen Leistungen. Auch die SPÖ hat sich im letzten Wahlkampf nicht als besonders telegen erwiesen. All das ist nur so lange ein wirklicher Mangel, als die Masse Wähler auf das Image gibt und nicht (oder noch nicht) die Bildkraft erfassen kann, die vom Wesentlichen kommt. Ich könnte mir denken, daß die SPÖ auf ihrem nächsten Parteitag zunächst nicht so sehr die neuen Methoden des Politischen diskutieren wird als neue Sachinhalte, die sie für ihre künftige Existenz und Aktion braucht. Im Interesse der österreichischen Demokratie wird man wünschen dürfen, daß es kerne Arbeit der Texters für die Writers in der Presse sein wird. Allen Parteien täte eine ernsthaft unternommene Selbstinterpretation not und nicht einfach die Erfindung auswechselbarer Images.
Der Parteitag findet in einer neuen Ausgangsposition des Sozialismus statt. Ich meine damit mehr als die Lage der Partei nach einer Wahlniederlage. Die Ausgangsposi-' tion der SPÖ im Jahre 1967 ist nicht mehr ident mit der der alten Arbeiterpartei vor 25 oder 50 oder 75 Jahren. Die Anzahl der Arbeiter schrumpft, die der Angestellten steigt, und in Wien macht der zahlenmäßige Unterschied nur noch 10.000 aus. Ohne ideologisch zu denken, würde ich dafür halten, daß Links heute wahrscheinlich eher eine bestimmte geistige Haltung ist. Auch der politische Gegner sucht solche Haltepunkte im politische Terrain, weil ohne solche Haltepunkte die „fliegenden Diskussionen“ (die heute zwischen Gegnern ohne Standpunkten geführt werden) leicht zu einem Hinundhergerede werden.
Was man nicht mehr ist
Auch die sozialistischen Parteien in Europa leiden vielfach unter dem, was lange zuvor das odiose Privilegium der bürgerlichen Parteien gewesen ist: in ihrer Selbstinterpretation spielt immer mehr die Feststellung eine Rolle, was man nicht (oder nicht mehr) ist. Die Diskussion, die darüber im Sommer 1966 in der „Arbeiter-Zeitung“ stattgefunden hat, ist die Dokumentation dessen. Wenn die SPÖ betont, sie (und niemand anderer) stehe immer auf der Seite der Mittellosen, der Schwächeren, der ins Unrecht Gesetzten, dann steht hinter diesem Anspruch zweifellos eine bestimmte geschichtliche Tatzeugenschaft. Der politische Gegner wird einen solchen Mono-polamtspruch bestreiten, und er wird es nicht ohne Erfolg tun können. Entscheidender (oder schwerwiegender) als dieser Widerspruch des Gegners ist aber die Tatsache, daß die Menschen, die heute in der Masse in einer neuen und im Entstehen begriffenen Mittelschicht (keine Proletarier, keine Bourgeois) existieren, von jeder politischen Partei weit mehr erwarten als das Anbot solcher Notbehelfe, mögen isie noch so ernsthaft geboten und benötigt werden.
Diese neue Mittelschicht (konsum-orientiert, besitzinteressiert, bildungsfähig) wird der Preis sein, um den in Zukunft die ganze politische Konkurrenz der politischen Parteien vor sich gehen wird. Eine Zeitlang begnügt sich diese Schicht mit interessanten Aktionsprogrammen und mit den Methoden einer polemischen Demokratie zu Wahlzeiten.
Auf die Dauer werden alte Parteien dem neuen politischen Typ nicht gerecht werden können. Was auf die Dauer den Menschen abgehen wird, das ist:
• Eine neue, auf die aktuelle soziale Situation bezogene soziale Strategie der Sozialpartner.
• Die Einbeziehung des Neuen in der Politik in eine lebendige Demokratie, das heißt: Mut zum Ersatz der historischen Modelle der Demokratie die aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen, die keinen Ewigkeitswert haben, durch Formen, die der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Situation im letzten Drittel des 20. Jahrhunderte entsprechen.
• Politische Parteien, die konform sind mit der Mentalität, die die Gesellschaft von heute ausstrahlt.
Persönliches
Ich erwarte nicht, daß die SPÖ der untergegangenen Koalition mehr widmen wird als ein ehrendes Angedenken. Für diese Koalition (oder für eine andere am ihrer Stelle) gibt es keine fröhlichen Urständ, solange der Selbstbehauptungswille der mit absoluter parlamentarischer Mehrheit ausgestatteten ÖVP stark genug ist, und sobald es die SPÖ wird ablehnen müssen, belastende Solidarverpflichtungen am Vorabend neuer Wahlentscheidungen auf sich zu nehmen.
Damit werden die Chancen eines eventuellen Koalitionsregimes nach 1970 (das im Falle einer relativen Parlamenltsmehrheit einer Partei unvermeidlich werden würde) nicht gerade rosig. Um so wichtiger wird es daher sein, die mehr auf die Sachpolitik bezogene Zusammenarbeit in den Landtagen und Gemeinden, in den Interessenverbänden und in den Partnerverhältnissen zwischen diesen Verbänden, im Städtebund und im Gemeindebund usw., ergiebig zu gestalten. Die Disparität: Konfrontation in der Bundespolitik und Koalition auf den anderen Ebenen kann zu sta* gnierenden Verhältnissen führen, sie muß es nicht; es wird nicht kommen, wenn die Brücken und Übergänge, die auch nach dem Abbruch der Koalition 1966 intakt geblieben sind, auf beiden Seiten gut instand gehalten werden. Das bedeutet keinen Rückschritt zu 1945.
Es ist bekannt, daß ich einen integralen Zusammenhalt von Sozialismus und Christentum nicht für möglich halte, aber ich erwarte viel von der geordneten Nachbarschaft eines fortschrittlichen Sozialismus und eines fortschrittlichen Christentums. Ich weiß, daß die modernen Theoretiker an der Wortbezeichnung „Christentum“ nagen werden. In diesem Punkt denke ich historisch und also nicht ideologisch, und die Geschichte befaßt sich mit der Existenz, nicht mit der Abstraktion. Auf eine solche Nachbarschaft wird es in Österreich, in 'Europa und in der Welt ankommen.
In wenigen Tagen, vom 30. Jänner bis zum 1. Februar 1967, findet der Parteitag der SPÖ statt. DIE FURCHE hat Vertreter beider Grofcparteien eingeladen, zum bevorstehenden Parteitag Stellung zu nehmen. Daff auf dieser Seite nur der Beitrag von Bundesminister a. d. Vizebürgermeister Dr. Heinrich D r i m m e I veröffentlicht ist und nicht auch ein Beitrag von sozialistischer Seite, Hegt nicht an uns. Eine uns unverständliche Maßnahme der SPÖ-Zentrale hat verhindert, dafj ein Gespräch Uber Parteigrenzen hinweg zustande kommt, daff dem profilierten Beitrag Dr. Drimmels ein ähnlich bedeutender eines angesehenen Sozialisten gegenübergestellt wird.
Die Redaktion