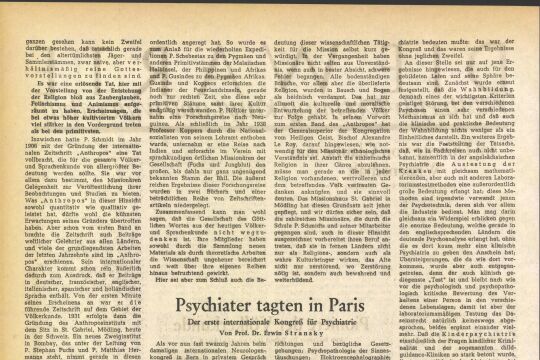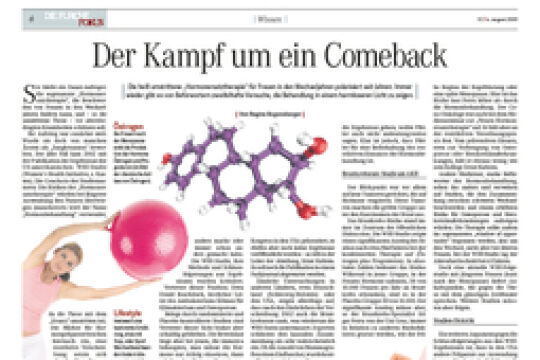Frauen schlucken zwar mehr Medikamente als Männer, in klinischen Studien waren und sind sie aber vielfach unterrepräsentiert. Die Bioethikkommission widmet dem Thema eine Tagung.
Diese Studie könnte Wellen schlagen. An der Medizinischen Universität Wien wurde erforscht, welches Präparat bei schwangeren Heroin-abhängigen Frauen sicherer und wirksamer ist: Methadon oder Buprenorphin. Beide Wirkstoffe werden in der Substitutionstherapie eingesetzt, um Menschen, die von Opiaten abhängig sind, zu stabilisieren. Die Forschungsarbeit, die von der Suchtexpertin Gabriele Fischer von der Medizinischen Universität Wien geleitet wird, wurde im Rahmen eines US-finanzierten Projektes durchgeführt. Die Ergebnisse im Detail können noch nicht veröffentlicht werden. So viel verriet Fischer im FURCHE-Gespräch aber vorweg: Die Kinder sind alle gesund, die Nachbehandlung der Babys ist aber unter Buprenorphin kürzer als unter Methadon.
Die Studie ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: Es ist eine seltene Studie, denn sie wurde an schwangeren Frauen durchgeführt – eine besonders sensible Gruppe, um Medikamente zu testen. Zugleich brauchen diese Frauen aber unbedingt Medikamente, denn sie würden ihre Gesundheit und jene des Kindes gefährden, würden sie wieder unkontrolliert Opiate und andere Drogen konsumieren.
„Role Model für andere Studien mit Frauen“
Daher ist Gabriele Fischer überzeugt: „Die Studie ist ein Role Model, weltweit das erste dieser Art.“ Sie zeigt auf, wie evidenzbasierte Studien an einer besonders sensiblen Gruppe durchgeführt werden könnten. Und das ausgerechnet an Opiat-abhängigen Frauen, die eine vergleichsweise kleine Gruppe darstellten, so Fischer. Doch in diesem Bereich gab es die Initiative zur Forschung. Nun könnte das Forschungsdesign auch bei anderen schwangere Frauen viel häufiger betreffenden Krankheiten wie etwa Bluthochdruck oder Depressionen angewendet werden, sagt Fischer. Solche Studien würden aus ethischen Gesichtspunkten freilich nur bei Frauen möglich sein, die ohnehin Medikamente nehmen müssen, und wo bereits ausreichend erwiesen ist, dass der Wirkstoff das Kind nicht schädigt.
Dass schwangere Frauen eine besondere Herausforderung für Forschende darstellen, leuchtet ein. Doch Frauen allgemein, vor allem solche im gebärfähigen Alter, waren lange bei vielen klinischen Studien zur Wirksamkeit von Medikamenten unterrepräsentiert bis ausgeschlossen – und das auch heute noch, wie Gender-Medizinerinnen oder die österreichische Bioethikkommission beklagen. Diese widmet daher dem Thema am 31. Mai eine Tagung (siehe unten). Die beliebte Testperson für viele Studien war männlich. Die Gründe seien zwar nachvollziehbar, so Expertinnen aus dem Bereich Gender-Medizin, aber dennoch nicht tragbar: Nach dem Contergan-Skandal (nach Einnahme des Schlafmittels kamen in den 60er Jahren zahlreiche Kinder zur Welt, deren Gliedmaßen fehlgebildet waren) wurden Frauen im gebärfähigen Alter nur sehr zögerlich, wenn überhaupt, in Studien einbezogen, obwohl viele dieser Medikamente später für beide Geschlechter auf dem Markt verfügbar sind. Zudem ist es billiger, einfach nur Männer zu nehmen.
Doch: „Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“, meint Gabriele Fischer. Diese Vorsichtsmaßnahme habe sich letztlich zum Nachteil der Frauen entwickelt. Beispiel „Aspirin“ als Herzinfarktprophylaxe. In der Studie, die eine schützende Wirkung nachweist, wurden aber nur Männer einbezogen. Als die Frauen nachgeholt wurden, stellte sich heraus: „Aspirin“ hat bei Frauen keine derartige schützende Wirkung.
Doch ab den 90er Jahren gab es ein Umdenken und die dementsprechenden veränderten internationalen Leitlinien und Gesetze, erklärt Marcus Müllner, Leiter der nationalen Zulassungsstelle für Arzneimittel Ages PharmMed. In der EU sei die Situation zurzeit zufriedenstellend, meint Müllner, aber man müsse wachsam bleiben. Erst jüngst wurde in der Zeitschrift Nature ein Artikel publiziert, dass in präklinischen Tests mehr männliche Tiere zum Einsatz kommen. Müllner hat in seiner früheren Position in der Zulassungsstelle der EU für Medikamente Zulassungsstudien zu 110 Substanzen, die zwischen den Jahren 2000 und 2003 durchgeführt wurden, untersucht, ob der Frauenanteil repräsentativ ist für den Anteil der Frauen in der Zielpopulation des Wirkstoffes. Das sei im Großen und Ganzen gegeben gewesen, so Müllner.
Zufrieden sind Gender-Medizinerinnen oder die Bioethikkommission im Bundeskanzleramt keineswegs: Geht man ins Detail vieler Studien findet man einige Mängel zu Ungunsten von Frauen und Männern: So würden viele Studienergebnisse nicht nach Geschlechtern ausgewertet, Frauen nicht in alle Phasen einer klinischen Studie eingeschlossen. Gerade in die Phase I, die die Sicherheit prüft, werden vorwiegend Männer einbezogen. In der Praxis schlucken aber auch gebärfähige Frauen diese Medikamente. Diese Kritikpunkte wurden von der italienischen Bioethikkommission festgehalten, die zeitgleich mit der österreichischen eine Empfehlung herausgab, Frauen in allen Phasen von Studien einzubeziehen. Und vor allem, wie auch Christiane Druml, die Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission, betont, müssten Frauen auch in entscheidenden wissenschaftlichen Gremien adäquat vertreten sein. Denn regierten hier mehr Männer, würden auch Themen, die Frauen (mehr) betreffen, eher stiefmütterlich behandelt, meint Druml. Das führe auch zu Defiziten in klinischen Studien. Ziel der Tagung sei es daher, für dieses Thema Bewusstsein zu schaffen. Das würde vor allem durch harte Fakten geschehen, ist Druml überzeugt.