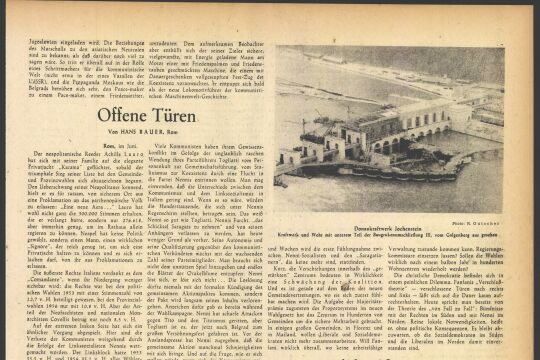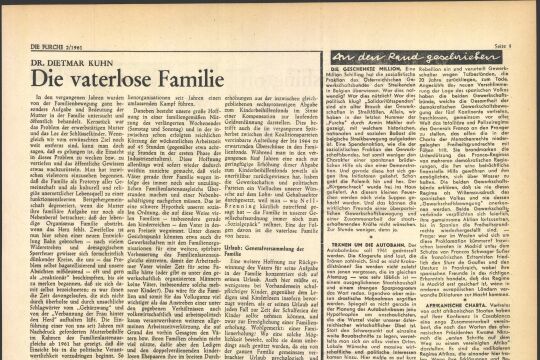Die neue Partei hat einen etwas langatmigen Namen: in kurzen Sigeln ausgedrückt wird sie PSI-PSDI (unificati) heißen, was auf Deutsch bedeutet „Vereinigte Sozialistische- Sozialdemokratische Partei Italiens“. Und etwas schwerfällig mutet die als Übergang gedachte Konstruktion der Parteispitze an, mit Pietro Nenni als Vorsitzenden, zwei Sekretären, Francesco De Martino (PSI) und Mario Tanassi (PSDI), zwei Vizesekretären, Giacomo Brodolini (PSI) und Antonio Cariglia (PSDI), bis hinunter zu den beiden Chefredakteuren des Parteiorgans „Avanti!“, von denen ebenfalls einer dem PSI und der andere dem PSDI angehörte. Wenn im kommenden November 1,2 Millionen Italiener zu administrativen Wahlen aufgerufen werden, wird die geeinigte Sozialistenpartei die beiden bisherigen Symbole nebeneinander zeigen. Das alles ist aber, wie gesagt, nur ein Übergang. Die Sozialdemokraten hatten den Wunsch, daß die politischen Wahlen 1968 noch unter dem alten Symbol ausgefoch- ten werden, denn sie fürchten, daß der viel verzweigtere und besser organisierte Apparat des PSI mehr Sozialisten als Sozialdemokraten den Weg in den Senat und die Abgeordnetenkammer öffnen könnte. So wird der erste Kongreß der neuen Partei erst nach jenen W ’den ein berufen werden, die letzten Bandagen werden dann gelöst und das Blut kann frei pulsieren.
Das Phänomen Nenni
Man kann die Vereinigung der sozialistischen Parteien als das bedeutsamste innerpolitische Ereignis der sechziger Jahre in Italien betrachten. Es ist geeignet, die Topographie des italienischen Parlaments zu verändern, ein neues Kräfteverhältnis zwischen den Parteien herbeizuführen und vor allem die Isolierung des Kommunismus und damit seine Dekadenz in Italien zu besiegeln. Zunächst ist mit großen Wandlungen nicht zu rechnen: die geeinigten Sozialisten denken nicht daran, das Bündnis mit der christlichen Demokratie aufzugeben und vom Kurs der linken Mitte abzuweichen. An dieser Formel lag es, daß die beiden Sozialismen überhaupt zusammenfinden konnten, die ideologischen und politischen Wahlverwandtschaften in einer täglichen Zusammenarbeit erprobend. Auch die Nenni-Partei hat sich, trotz manchem inneren Widerstreben, den
Phänomenen der Zeit und der Evolution nicht zu entziehen vermocht. Sie war, ein Kuriosum, die letzte sozialistische Partei im Westen gewesen, die an der Erstausgabe des Marxismus festhielt und im Namen eines Begriffes, der nicht einmal in der kommunistischen Welt feste Wirklichkeit geworden ist, nämlich „Einheit der Arbeiterklasse“, bis an den Rand einer Fusion mit den Kommunisten gelangte. Der Mann, der dies angestrebt hat, hieß Pietro Nenni. Der Mann, der mit zielbewußter Entschiedenheit die Kommunisten dann aus der Tür des Sozialismus gedrängt und sie dann zugeschlagen hat, heißt ebenfalls Pietro Nenni. In dieser Entwicklung hat es viele Nuancen und Stufen gegeben. Daß sie stattgefunden hat, ist nicht ein Zeichen leichter Meinungsänderung, sondern für die bewunderungswürdige Fähigkeit des Fünfundsiebzig jährigen, die Zeichen der Zeit zu spüren, zu erkennen und entsprechend zu handeln. Der Sozialismus hat in England, in Deutschland, Österreich, Frankreich, in den skandinavischen Ländern seinen Weg gemacht. Von irrtümlichen Dogmen beschwert, hat der italienische (hier ist natürlich nicht von den Sozialdemokraten Saragats die Rede) nicht Schritt zu halten vermocht. Das unnütz gewordene Gepäck abwerfend, sucht er nachzueilen.
Isolierte Kommunisten
Das wird ihm erleichtert durch die ideologische Krise in der KP. Die Hoffnung auf eine gemeinsame Machtübernahme hat seinerzeit zu dem Pakt der Aktionseinheit zwischen Sozialisten und Kommunisten geführt. In Wirklichkeit haben die Kommunisten die Macht nur in den gemeinsamen Organisationen, im Gewerkschaftsbund, in den Genossenschaften übernommen. Die Idee einer kommunistischen Revolution in Italien ist heute ebenso absurd wie die einer Machtergreifung mit legalen Mitteln, durch die Zustimmung der Wählerschaft. Die Kommunisten haben keine andere Alternative anzubieten als die Volksfront. Um ihr Freunde zu werben, bietet die KP den pluralistischen Staat, das
Mehrparteiensystem, den Parlamentarismus, das Fortbestehen des Privateigentums, den Modus Vivendi mit der Kirche an, aber weil ihr das alles wesensfremd und wider die eigene Natur ist, weil es ihrer inneren Logik widerspricht, muß sie das Entstehen von Strömungen und offenen Widersprüchen an der Spitze und an der Basis der Partei hinnehmen.
Parteisekretär De Martino sagt, er sei nicht dogmatisch genug, um ein Zusammengehen mit den Kommuni sten in einer künftigen Regierung automatisch auszuschließen. Aber unter einem realistischen und praktischen Gesichtspunkt scheint ihm das Problem nicht zu bestehen. Denn die Sozialistenparted hat jetzt die Zugehörigkeit zum Gemeinsamen Markt, zum Atlantikpakt, zu allen westlichen Bündnissen, die Sozialreformen ohne Gefährdung der Wirtschaft im Programm stehen. Zu allen diesen Dingen müßten die Kommunisten, wenn sie mit den Sozialisten gemeinsam eine Regierung bilden wollten, Ja sagen. Aber könnten sie es tun? Wenn sie es täten, würden sie aufhören, Kommunisten zu sein. Anderseits: könnten die Sozialisten diese Grundsätze ihres Programmes aufgeben? Wenn sie es täten, würde die neue Partei sofort wieder auseinanderbrechen. Das schließt nicht aus, daß die Sozialistenpartei noch Kontakte mit den Kommunisten hat. Die Gewerkschaftsfrage ist so gelöst worden, daß den Mitgliedern freigestellt bleibt, ob sie der sozialdemokratisch inspirierten UIL oder der kommunistisch-linkssozialistischen CGIL angehören wollen. Aber die scheinbare Indifferenz hat ihren Grund nur in dem Wunsch, die Wässer nicht zu sehr aufzurühren und jetzt keine zusätzlichen Widerstände gegen die Fusion zu schaffen. Das Ziel bleibt doch ein gemeinsamer Gewerkschaftsbund und das Fernziel eine einzige überparteiliche Gewerkschaft in Italien, falls sie nicht ein ähnliches Trugbild ist wie die Einheit der Arbeiterklasse. Die Zusammenarbeit mit den Kommunisten kann bestehen bleiben in Gemeinden, wo kein anderer arbeitsfähiger Ausschuß möglich wäre und ein Regierungskommissar in Kauf genommen werden müßte. Aber wichtige Bastionen der kommunistischen Verwaltung sind bereits zusammengestürzt und täglich melden die Zeitungen das Ende weiterer solcher Machtpositionen, weil sich die Sozialisten zurückgezogen haben. In bedeutendien Organisationen, zum Beispiel im Landwirteverband kommunistischer Prägung, ist die Trennung vollzogen.
Die Furcht ist geschwunden
Seit mehr als 20 Jahren ist die Existenz einer starken — der stärksten im Westen — kommunistischen Partei das Problem Nr. 1 der italienischen Politik gewesen. Die Furcht vor dem Kommunismus hat ihr den Stempel aufgedrückt, sie bedingt. Das Problem besteht fort, aber die Dimensionen haben sich verringert. Die Furcht ist so gut wie geschwunden. Daß dieses Resultat erreicht wurde, ist nicht zuletzt eine Folge der sozialistischen Einigung. Vielleicht ist es um dieses Resultats willen und der Konsequenzen, die sich noch daraus ergeben können, daß die Kirche zum erstenmal in der Geschichte eine nichtkatholische sozialistische Partei zwar nicht anempfiehlt, aber ihr auch nicht feindlich ist. Der Prozeß der Wiedervereinigung im italienischen Sozialimus ist durch keine verantwortliche kirchliche Stelle jemals gestört worden. Man hat ihn ignoriert.
Um so eifriger haben sich katholische Politiker, Organisationen und Publikationen mit den eventuellen Konsequenzen für die Democrazia Cristiana auseinandergesetzt. Die wirklich verantwortlichen Politiker, also jene, die die Mehrheit innerhalb der christlich-demokratischen Partei vertreten, haben die Fusion im Sozialismus akzeptiert als einen notwendigen Beitrag zur Demokratisierung Italiens. Nur in den integra- listischen Kreisen ist man schok- kiert von der Möglichkeit, daß um das Übergewicht der DC in einem echten ideellen Wettbewerb gerungen werden muß.
Konzessionen nach links und rechts
Welchen Weg der italienische Sozialismus in der Zukunft ein- schlagen wird, kann erst sein Handeln in den nächsten Jahren erwei sen. Die „Charta“, das Programm, sagt nichts, oder fast nichts darüber aus. Das Dokument ist von Pietro Nenni verfaßt worden und vermutlich die letzte große Mühe des greisen Politikers. Es ist wohl nicht sein bestes Werk. Zu sehr spürt man den Zwang heraus, den augenblicksbe- dingten Notwendigkeiten zu weichen und die Diskrepanz der Meinungen von rechts und links in eine erträgliche Mischung zu bringen. Es fehlt dem Dokument das Absolute, was über die Zeit oder zumindest über eine längere Zeitspanne hinweg erhebt, wie es zum Beispiel im Godesberger Programm zum Ausdruck kommt. Um die Widerspenstigen in seiner eigenen Partei zu beruhigen, wendet er eine marxistische Sprache an und entwickelt marxistische Konzepte, die von dien jüngeren Generationen nicht mehr ohne weiteres hingenommen werden. Aber die Begriffe, das Programmatische, sind modern und sozialdemokratisch. Nenni beruft sich auf die doktrinären Erfahrungen seiner Partei, „angefangen von der grundlegenden des Marxismus“, um zu einer Gesellschaft zu gelangen, die von Widersprüchen und der Zwangsausübung befreit ist. Diese wieder sind das Ergebnis der vom kapitalistischen System hervorgerufenen Klassenspaltung. „Die Demokratie kann nur mit dem Sozialismus integral durchgeführt werden“, schließt er.
Zusammenarbeit möglich
Nach dieser Konzession an die Orthodoxen in seiner Partei reicht er aber sofort den „anderen politischen demokratischen Kräften“ die Hand und beruhigt sie: „Gegenüber den Kommunisten besteht für die
Sozialisten eine streng ideelle und politische Front, die von dem Grundsatz herrührt, daß es keinen Sozialismus geben kann ohne eine demokratische Organisation der Partei, der Gesellschaft und des Staates.“ Gelegentliche Zusammenarbeit mit den Kommunisten ist möglich, aber „nicht ohne kritische und polemische Gegenüberstellung des gedanklichen Inhalts von Sozialismus und Kommunismus“. Bezüglich des kapitalistischen Systems wird auf Kritik und Kampf nicht verzichtet, aber es wird anerkannt, daß sich die ausschließliche staatliche Initiative in der Wirtschaft nicht als wirksam erwiesen hat. Die Planwirtschaft und die Reformen sind durchzuführen, aber in einer Weise, daß die Reaktionen jener, die von den Reformen betroffen werden, sich nicht auf die Lage der Arbeiter auswirken.
House. Hinter verschlossenen Türen konferierten Harold Wilson, Commonwealthminister Herbert Bowden, dessen Stellvertreterin Mrs. Judith Hart, der Kabinettssekretär Sir Burke Trend und Malcolm Macdonald, der britische Sonderbotschafter in Ost- und Zentralafrika. Nach Meinung gut informierter Kommentatoren hat man in dieser Klausur beschlossen, am Dienstag eine andere Taktik einzuschlagen. Ohne allzusehr von seiner Linie abweichen zu müssen, sollte die Forderung nach NIBMAR in größerem Maß berücksichtigt werden, als dies bis dahin geschehen war. Falls Mr. Smith und seine Regierung in Salisbury weiterhin Verhandlungen mit Großbritannien ablehnten, würde sich London nicht mehr an die frühere Zusicherung einer Minderheitsregierung mit entsprechenden eingebauten Sicherungsklauseln gebunden fühlen.
Dieser Gesinnungswandel entsprang offenbar der Furcht, die
17 NIBMAR-Länder könnten im Herbst in New York bei der UNO Anträge für eine allgemeine Blok- kade Rhodesiens, Mozambiques und Südafrikas ednbringen, Anträge, die London wegen seiner prekären außenwirtschaftlichen Lage nicht gelegen gekommen wären.
Dienstag morgen suchten die Vertrauensleute des Premierministers nach Kontakten mit den Schlüsselfiguren der heurigen Konferenz. Als solche hatten sich in den vorherigen Tagen immer klarer der Vizepräsident von Kenya, Jo Murumbi, Tom Mboya, der Präsident von Uganda Obote, und der Minsterpräsident von Sierra Leone, Sir Albert Margai, in den Vordergrund geschoben. Mr. Macdonald war freilich nicht der einzige, der nach Kontakt suchte. Auch die Afrikaner waren entsetzt über einen möglichen Zusammenbruch des Commonwealth und beauftragten Mr. Murumbi und Mr. Mboya, Premierminister Wilson davon zu überzeugen, daß es nicht mehr so weitergehe. Und so trafen sich die Emissäre und kamen unverzüglich überein, daß Mr. Wilson noch einmal seine Chance haben sollte. Zunächst wollte der Premierminister eine Entscheidung hinausschieben, indem er eine Vertagung der Konferenz um drei Monate anstrebte. Dieses Ansinnen wurde allgemein als abwegig abgelehnt. Zwei Kanadier, Premierminister Lester Pearson und der Generalsekretär Arnold Smith, machten sich von sich aus an die undankbare Aufgabe, ein Kommunique zu entwerfen, das von allen Delegationen unterzeichnet werden konnte.