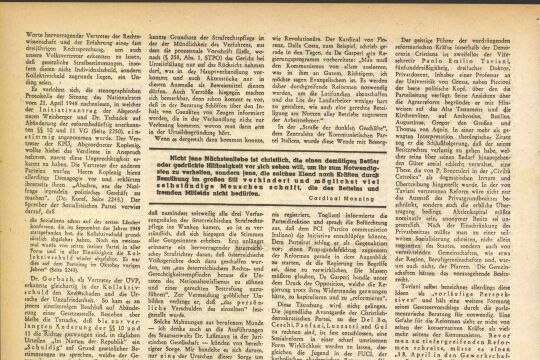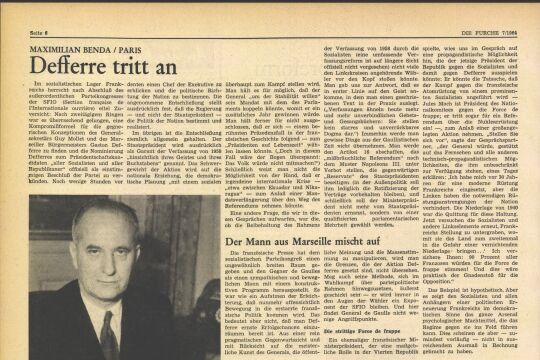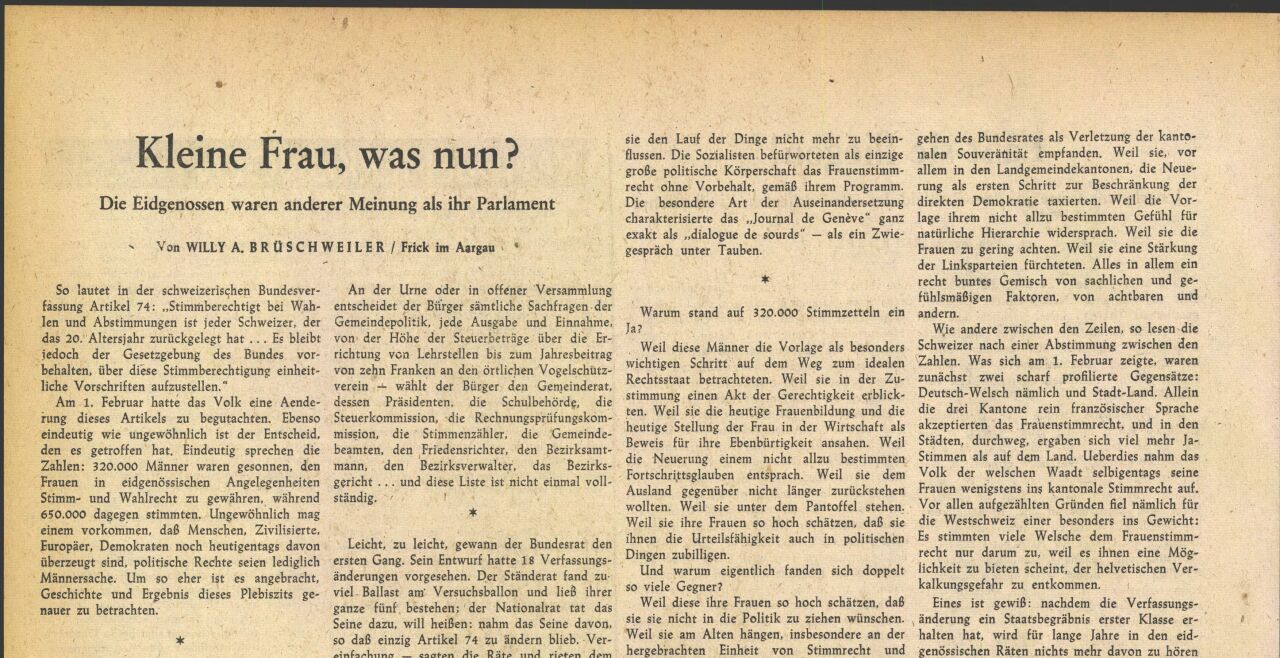
Ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung Italiens ist dem Festival des Schlagerliedes in San Remo vor den Fernsehapparaten mit großer Aufmerksamkeit gefolgt. Halb Italien hat die Ergebnisse des Wettbewerbes als äußerst befriedigend empfunden und’ audv-in durchaus positivem Sinne kommentiert. Ist doch als Sieger zum zweitenmal der Apulier Domenico Modugno hervorgegangen, der schon vor einem Jahr mit seinem „Fliegen, oh oh..die Freunde der leichten, sehr leichten Musik in ein Delirium der ‘Begeisterung versetzt hat. Diesmal winkte ihm der Preis mit dem Lied „Piove” („Es regnet”); da sich an zweiter Stelle das” Lied „Vento” („Wind”) placierte, könnte man von einem Festival des Schlechtwetters sprechen.
In den gleichen Tagen war in Rom die politische Witterung gewittrig: Schwüle, dumpfes Donnergrollen und Blitzschläge erschreckten jene Minderheit des italienischen Volkes, die nicht durch die Vorgänge in San Remo abgelenkt war. Es hat Augenblicke gegeben, in denen die demokratischen Einrichtungen ‘des Staates wie duęch ein Erdbeben erzitterten. Zumindest hatte es so geschienen, mag sich auch jetzt, nachdem sich das Gewitter in die Ferne verzogen hat, auf den noch blassen Lippen ein freieres Lächeln zeigen.
Die Beauftragung des sardischen Universitäts- Professors Antonio S e g n i mit der Regierungsbildung hat der römischen Krise zwar noch kein Ende gemacht, sie jedoch in ruhigere Fahrwasser gelenkt. Mit einem Seufzer der Erleichterung blickt man auf die überstandene Gefahr zurück.
Es ist schwer zu sagen, an welchem Tag die politische Krise in Italien wirklich begonnen hat. Vielleicht bereits am 1. Juli 1958, als Amintore Fanfani, politischer Sekretär der Christlichen Demokratie, die Posten des Ministerpräsidenten und des Außenministers annahm. Er hatte nach Jahren mühevoller Örganisationsarbeit und kapillarer Durchdringung des Landes einen mächtigen Parteiapparat aufgebaut und da: Kreuzschild zu einem glänzenden Sieg geführt Für die 13 Millionen Wählerstimmen könnt man sich schon dankbar zeigen: Fanfani hat ein Machtfülle in seiner Hand vereinigt, wie si Degasperi kaum jemals besessen hatte. Abei Degasperi war tatsächlicher Herr der Partei gewesen. Gewiß, auch er hatte viel Sorge mit der verschiedenen Strömungen in der Massenparte: - nicht zuletzt durch die „Iniziativa Demo- cratica” Fanfanis —, und auch ihm haben di Heckenschützen im Parlament zeitweilig arg zugesetzt. Doch war Degasperi ein Meister des Kompromisses und vermochte auch hartnäckige Widersacher, wie etwa Giovanni Gronchi, innerhall des magischen Zirkels der Partei festzuhalten. Fanfani hat die Partei nicht für sich gewonnen, sondern am Petėr-und-Pauls-Tag des Jahres 1954 im Handstreich erobert. Mit den Wahlen am 25. Mai 1958 nahm er auch die Regierung. Das offizielle Parteiorgan, der „Popolo”, publizierte ‘ noch tagelang die Glückwunschtelegramme der Anhänger: „Unfehlbares Haupt”, „Sicherer Führer”. „Zuverlässiger Kapitän” . . nannten ihn jene Freunde, die 190 Tage später, am vergan-genen 26. Jänner, ihm den dringenden Rat gaben, zu demissionieren.
Vielleicht hätte er es schon zehn Tage früher tun sollen, in jenem Ministerrat, wo sich Fan- fani sogar gegenüber seinen Ministerkollegen in der Minderheit sah. Die Angelegenheit des Volkswahnhausbaues in der Provinz Bozen war zur Sprache gekommen. Fanfani hatte den Senatoren der Südtiroler Volkspartei, dem österreichischen Botschafter bei der italienischen Regierung, Max Löwenthal-Chlumecky, dem Außenminister Oesterreichs Leopold Figl anläßlich der Ueberreichung des Erasmus-Preises in Mailand befriedigende Zusicherungen gemacht. Im Ministerrat stieß er auf den Widerstand des Parteifreundes Togni (von dem eines der herzlichsten Glückwunschtelegramme gestammt hatte), der als Minister für Oeffentliche Arbeiten den Volkswohnhausbau in der Provinz Bozen unter seiner Kontrolle haben wollte; Togni fand starke Unterstützung bei dem sozialdemokratischen Arbeitsminister Vigorelli. „Dir kommt es nur auf die drei Südtiroler Stimmen an!” schrie er dem Ministerpräsidenten entgegen. „Das hat nichts damit zu tun!” wehrte sich Fanfani. „Wenn es nichts damit zu tun hat, dann lassen wir sie fallen!” Die meisten Minister schlossen sich der Meinung an, und Fanfani beugte sich ihrem Willen.
Togni und Vigorelli sind dann die bei- ‘den Minister gewesen, die durch ihren Rücktritt Fanfani die Unvermeidlichkeit seines Schicksals klar machten. Ihr persönliches Format ist hier belanglos, sie agierten als Vorboten jener Zan- genbewegung, in der sich Fanfani festklemmen sollte. Die Krise war eine doppelte: in der Christlich-demokratischen Partei und bei der Sozialdemokratie. Bei der Democrazia Cristiana war es der Angriff von der Rechten her, bei den Sozialdemokraten einer von der Linken. Dort waren die Interessengruppen entschlossen, Fan- fanis Lebensfaden noch vor dem Parteikongreß im April in Florenz abzuschneiden; hier war der linke Flügel der Partei ebenso entschlossen, ohne weiteren Verzug die sozialistische Wiedervereinigung durch den Austritt aus der Regierung und den Eintritt in die linkssozialistische Partei Nennis zu vollziehen.’ Die Krise in der christlichdemokratischen Wahlgemeinschaft — denn sie gleicht mehr einer solchen, als einer Partei — ist mehr konstitutionell bedingt als durch den Egoismus und die Ambitionen einiger ihrer Exponenten hotvorgerufen.. Degasperi hat eine über den Klassen stehende Partei vorgeschwebt, bei der die gemeinsame christliche Ideologie verschmelzend wirken sollte. Aber eine katholische Partei ist nur in einem nichtkatholischen Land vorstellbar. Ebensowenig wäre etwa in England eine protestantische Partei oder in Aegypten eine mohammedanische denkbar. So nehmen in Italien die Monarchisten für sich in Anspruch, nicht weniger katholisch zu fühlen wie die christlichen Demokraten. Der Interessenzwiespalt erwies sich zeitweilig stärker als dai gemeinsame christliche Bekenntnis. Wir finden tatsächlich in der DC die Rechtsgruppen eines Scelba, eines Pella, eines Andreotti, die weitgehend Unternehmerinteressen vertreten; wir finden im Zentrum die „Iniziativa Democratica”, die jedoch mindestens drei Untergruppen aufweist; wir finden die kompakte Abgeordnetengruppe der Landwirte, unserem Bauernbund vergleichbar, unterstützt von den Agrargenossenschaften; wir finden auf der Linken die Arbeiter der Katholischen Aktion, die Gewerkschafter, schließlich eine rasch anwachsende „Linke der Basis”, die offen für ein Bündnis mit den Sozialisten Nennis eintritt. Diese Gruppe findet aber die Stütze des scheinbar allmächtigen und finanzstarken Präsidenten des staatlichen Erdölholdings ENI, Enrico Mattei, und dieser wieder ist mit dem Staatspräsidenten Giovanni Gronchi politisch eng verbuilden. Es heißt, daß Mattei während der Krise recht eifrig an den Fäden gezogen hat.
Fanfanis Entschluß ist plötzlich und überraschend gekommen. Nicht nur für die Oeffent- lichkeit, sondern auch für seine nächsten Freunde, für den Staatspräsidenten, mit dem er doch kurz zuvor ein Gespräch gehabt hatte, und den er in peinliche Verlegenheit setzte. Wer ihm in diesen Tagen nahe war, fand ihn völlig verändert; Der wegen seiner Tatkraft und seiner unaufhörlichen Aktivität bekannte Mann war nicht mehr wiederzuerkennen; er blieb untätig und uninteressiert an allen Regierungs- und Parteigeschäften, überflog kaum die Zeitungen, verbrachte den Tag im Lehnstuhl. Höchstens unternahm er einen kleinen Spaziergang am Arm seiner Gattin Bianca Rosa oder unterhielt sich mit der Schar seiner sechs Kinder. Dafür hat er die spirituellen Gewohnheiten seiner Jugend wieder aufgenommen; ‘täglich geht er zur Messe, liest dann zu Hause die Schriften des hl. Augustinus und des hl. Franziskus, Papini, Pėguy … Täglich telephoniert er mit seinem Freund La Pira in Florenz und führt mit ihm lange Gespräche über religiöse Dinge. „Dossetti, ja, der hat alle Probleme überwunden, der hat das andere Ufer erreicht”, habe Fanfani zu seinen Freunden, dem Vizesekretär der DC, Rumor, und zu dem Gewerkschafter Pastore gesagt. Giuseppe Dossetti hat vor einigen Wochen das Priesterkleid angelegt. Er war der dritte von den „pro- fessorini” im Schweinchenklub, so genannt nach einem aus Holz geschnittenen Schweinchen, das wie ein Emblem in dem Philippinerheim an der Chiesa Nuova hing, wo sich Fanfani, La Pira, Dossetti und andere in den ersten Nachkriegsjahren zu endlosen Diskussionen über ihre zukünftige politische Aktion versammelten. Dossetti ist als erster aus der Politik gegangen, La Pira ist noch Abgeordneter, er hat aber aus Florenz nicht das neue Jerusalem, die mystische Friedensstadt, zu machen vermocht, und nicht einmal in der Gemeindestube haben sein reines Wollen und sein argloses Herz den Frieden erhalten können. Als letzter hat jetzt Fanfani der Politik ade gesagt. Er tat es in einer Weise, die Unglauben und Erstaunen hervorgerufen hat. Im Palazzo Chigi, dem Außenministerium, und im Viminalpalast, der Ministerpräsidentschaft, ließ er sich ebensowenig sehen wie in der Parteizentrale an der Kirche Gesü. Für die Freunde war er nicht mehr auffindbar, nicht einmal für den Staatspräsidenten, der ihm den Auftrag, die Demission zurückzunehmen, in einem Brief zustellen ließ, damit er nicht erst aus den Zeitungen von dieser Entscheidung erfahre. Aber Fanfani war nicht im Hause, er befand sich in einem Kloster, um in der Stille weltfremder Abgeschiedenheit über die Welt nachzudenken.
Die vierte krisenhafte Erscheinung wurde der Konflikt zwischen dem Staatspräsidenten Gronchi und der Christlich-demokratischen Partei, manche behaupten; mit dem Parlament. Gronchi scheint der Ansicht gewesen zu sein, daß ihm die Verfassung das Recht gebe, nicht nur die Person des mit der Regierungsbildung beauftragten Ministerpräsidenten zu bestimmen, sondern auch auf die Zusammensetzung des Kabinetts und auf das Programm Einfluß zu nehmen. Er wollte den Auftrag dem bisherigen Innenminister Tambroni geben, der auf der Vorschlagsliste der Christlich-demokratischen Partei nicht gestanden war. Die Parlamentsgruppen der DC wieder wollten dem Staatspräsidenten nicht mehr als die Rolle eines Schiedsrichters, keineswegs die des Hauptakteurs im politischen und parlamentarischen Kampf zuerkennen. „Wir befinden uns einer neuen Willenskundgebung des Staatsoberhauptes gegenüber”, schrieb die liberale „Nazione”, „in einem Augenblick der Verwirrung und einer seinen Plänen günstigen Krise eine Art Präsidentialrepublik herzustellen, wie sie von unserer Verfassung nicht in Betracht gezogen wird.” Gegen solche Absichten Gronchis erhoben sich sofort erbitterte Widerstände. Das vierköpfige Regentschaftskomitee, die Führer der beiden Parlamentsfraktionen, die Parteidirektion waren sich plötzlich einig und bereit, den Kampf gegen einen „Uebergriff” des Staatspräsidenten aufzunehmen.
Der Konflikt kam in einem scharf polemischen Kommunique des Staatspräsidenten zum Ausdruck, mit dem er Fanfani wieder vor das Parlament schicken wollte. Zugleich trat aber auch schon zutage, daß Gronchi gegenüber dem festen Willen der Parlamentsfraktionen zurückgewichen war. Die neuerliche und endgültige Absage Fanfanis enthob die Christlich-demokratische Partei schwieriger Entscheidungen, aber die Situation schien nun heillos in Verwirrung geraten und, man konnte sich kaum eine andere Lösung vorstellen afs die Auflösung der Kammern, wozu der Staatspräsident berechtigt gewesen wäre. Doch Gronchi ließ wissen, daß er einen neuen Zyklus von Konsultierungen eingeleitet habe. Es ging ein Aufatmen durch Rom. Nun war offenkundig, daß Gronchi nachgeben wollte. So kam die Berufung Segnis, des Mannes, den die Partei an die Spitze ihrer Kandidaten gestellt hatte.