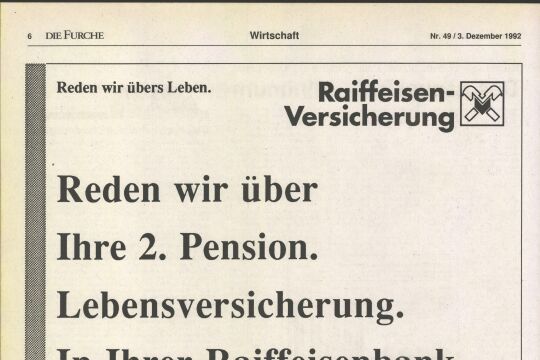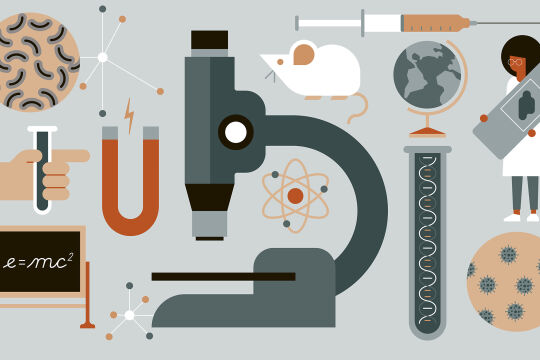"Gen-Mais verringert die Fruchtbarkeit", kommentierte Greenpeace eine aktuelle Studie. Der Wirbel war groß. Nebenbei ging eine andere brisante Studie im medialen Getöse unter.
Mitte November präsentierte Professor Jürgen Zentek von der Veterinärmedizinischen Universität in Wien das Ergebnis eines speziellen Langzeitfütterungsversuchs von Mäusen mit einem bestimmten genetisch veränderten Mais (kurz: GV-Mais). "Verzehr von Gentech-Mais verringert Fruchtbarkeit" titelte daraufhin Greenpeace und der Nachrichtendienst Glocalist schrieb: "Gen-Mais macht impotent." Jens Karg, Gentech-Experte bei Global 2000, kommentiert die Studie so: "Die Erkenntnis daraus ist, dass das Zulassungsverfahren, wie es derzeit von der EFSA (Anm. die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) praktiziert wird, keine Sicherheit bietet." Und weiter: "Wir haben mit dieser Studie ein Mittel, das ein nationales Importverbot rechtfertigt, und das wäre meiner Ansicht nach das Gebot der Stunde."
Viel Wirbel um eine Studie
Doch was meint Zentek selbst zu den weitreichenden Forderungen, die jetzt NGOs aus seiner Studie ableiten? "Ich möchte mich damit meiner Meinung zurückhalten", und fügt hinzu: "Solange man das Ergebnis nicht in einem Überprüfungsversuch abermals bestätigt hat, ist es eine Einzelbeobachtung. In einem anderen Versuchsdesign (sogenannte Mehrgenerationenstudie) haben sich keine Unterschiede gezeigt. Wir können überhaupt nicht einschätzen, wie das genau zu bewerten ist."
Man kann das als Herunterspielen des Resultats werten. Denn vielleicht hat der Wirbel um seine Forschungsarbeit - und der damit entstandene politische Druck - den Studienmacher ja doch überrascht? "Jeder Forscher, der kritische Ergebnisse publiziert, muss mit viel Gegenwind rechnen. Es gibt ein massives Lobbying seitens der Biotech-Industrie. Als in Mexiko gentechnisch kontaminierter Mais gefunden wurde, hat man versucht, die Autoren zu diskreditieren", sagt etwa Karg.
Doch die Haltung von Zentek könnte auch Ausdruck seiner bescheidenen Wissenschafternatur sein. Natürlich weiß er, dass die Reduzierbarkeit zu überprüfen ist. Andere Faktoren müssen ausgeschlossen werden. Anders als die Schlagzeilen insinuieren, hat das Experiment keinen direkten kausalen Zusammenhang zwischen der genetischen Modifikation des Maises und der verringerten Fruchtbarkeit erbracht. Auf der Onlineplattform www.transgen.de etwa suchen Forscher nach Erklärungen für das für manche unerwartete Resultat. (Im Forum diskutieren vor allem Forscher, da die Anforderungen sehr hoch sind - unter anderem sollen stets Literaturangaben gemacht werden. Die Webseite selbst bietet aber auch für den Laien gut verständliche Informationen zum Thema).
Einer bemerkt etwa, dass der gentechnisch veränderte Mais im besagten Langzeitversuch einen viermal höheren Gehalt an Zearalenon aufwies als der Mais der Kontrollgruppe. Zearalenon ist ein Schimmelpilzgift, das auf vielen Pflanzen vorkommen kann - und es kann eine östrogen-ähnliche Wirkung haben und bei steter Zufuhr zu Fruchtbarkeitsstörungen führen. Der wahre Grund für Fruchtbarkeitsstörung? Nein, aber eine interessante Spekulation, die es wert wäre, mit weiteren Versuchen geprüft zu werden. Genau das fordert letztlich auch Zentek, wenn er in der Kurzfassung seines Berichts schreibt: "Daher ist es dringend notwendig, den Einfluss der Futtermittel auf die Zucht detailliert zu untersuchen."
Wenig Wirbel um eine zweite Studie
Bei der Aufregung um die Langzeitfütterungsstudie ging eine andere, mindestens ebenso brisante Studie, die auf der gleichen Pressekonferenz präsentierte wurde, medial völlig unter. Markus Wögerbauer von der Medizinischen Universität Wien konstatierte in seinem Bericht "gravierende Mängel" in der derzeitigen Risikoabschätzung von sogenannten Antibiotikaresistenz-Genen (kurz: AR-Gene), die als Marker in genetisch veränderten Organismen eingesetzt werden (näheres dazu in Infobox, rechte Spalte). Sollten Bakterien in der Umwelt diese Gene aufnehmen, so könnten sich verstärkt antibiotikaresistente Stämme bilden. Das wäre ein höchst unwillkommener Effekt, weil als Folge davon auch Antibiotika-Medikamente unwirksam werden könnten.
Das EFSA GMO Panel hat das Problem zwar erkannt und auch Kriterien für eine Risikoabschätzung aufgestellt. Wögerbauer bemängelt aber beispielsweise, dass das Panel "im Wesentlichen und undifferenziert" davon ausgeht, dass es in natürlich vorkommenden Bakterienpopulationen bereits viele Resistenzen gibt. Das hieße, dass GV-Pflanzen also - wenn überhaupt - nur einen geringen Beitrag zu weiteren Resistenzbildungen beitragen würden. Für zwei konkrete Resistenzen (gegen Penicillin und Kanamycin/Neomycin) findet er für Europa, dass "sie in zahlreichen Habitaten und bei mehreren Referenzstämmen äußerst selten vorkommen".
Risikolose Antibiotikaresistenz?
Des Weiteren kritisiert Wögerbauer, dass das Panel gewisse Antibiotika für medizinische Zwecke als nicht mehr relevant erachtet und sie deshalb als risikolos einstuft. Hier würden länderspezifische Unterschiede einfach übergangen. Und nennt als Beispiel Kanamycin: In Österreich wird dieses Antibiotikum im humantherapeutischen Bereich gar nicht eingesetzt; in Estland ist es hingegen erst kürzlich in den nationalen Tuberkulose- Therapieplan aufgenommen worden. Am Schluss seines Berichts empfiehlt Wögerbauer, dass das Risiko länderspezifisch und in einem Case-by-case-Verfahren neu abgeschätzt werde. Dafür zuständig sollte die jeweilige nationale Behörde sein. Doch auch hier wäre wiederum einiges an Forschungsarbeit nötig. Denn: "Zu groß sind gegenwärtig noch die Unsicherheiten und Wissenslücken, der Mangel an repräsentativen quantitativen Daten, um die lokalen Unterschiede bei Resistenzraten und Antibiotikaverbrauch."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!