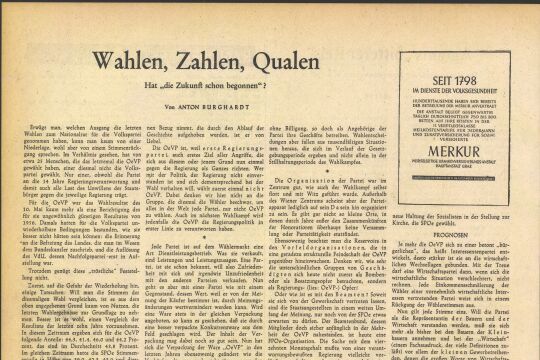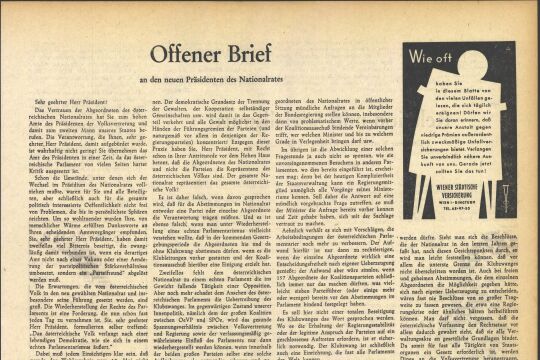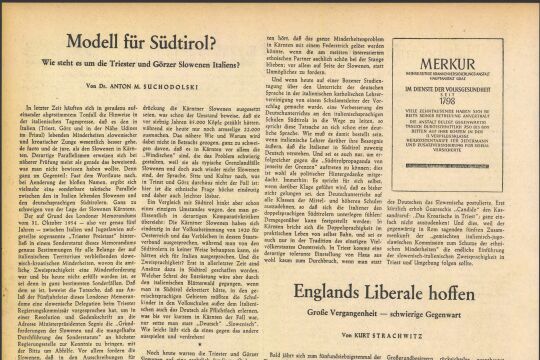Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wahlrecht und Demokratie
Gewichtige Gründe waren es, welche die Gesetzgebung der ersten österreichischen Republik veranlagten, die Wahlmethode zu verlassen, nach der noch in den Jahren 1907 und 1911, in den ersten Wahlen des allgemeinen gleichen Stimmrechts, die Mandatsverteilung erfolgt war. Die 516 Abgeordneten des alten österreichischen Reichsrates waren noch aus ebenso vielen Einzelwahlkreisen hervorgegangen; für sie hatte die absolute Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen entschieden; war im ersten Wahlgang für keinen der Bewerber die absolute Mehrheit erreicht worden, so bestimmte zwischen jenen zwei Kandidaten, denen die größte Stimmenzahl zugefallen war, eine Stichwahl über die Mandatszuteilung. Dieses System, das jedem Wahlkreis einen Abgeordneten gab und den Gewählten unmittelbar mit der Wählerschaft seines Wahlbezirkes konfrontierte, hatte den Vorzug, daß es den Volksvertreter anwies, fortgesetzt sich um die Gesamtinteressen seines Wahlbezirkes zu kümmern, wenn er anders seine Stellung gut verankern wollte. Aber es hatte den empfindlichen Nachteil, daß Minderheiten, mochten sie in den einzelnen Kreisen noch so groß sein, unberücksichtigt blieben oder aber sogar relative Wählermehrheiten durch Wahlbündnisse der Minderheiten um ihr Anrecht gebracht werden konnten. Zum klassischen Beispiel wurden die Juniwahlen des Jahres 1911, in denen die Christlichsozialen, die in den ersten Wahlen des allgemeinen gleichen Wahlrechts vier Jahre zuvor mit 96 Mandaten die größte Parteieneinheit des Parlaments geworden waren und vierzig Prozent der gesamten deutschen Wählerschaft Altösterreichs in ihren Reihen gesammelt batten, auf 76 Mandate zurückfielen, weil in vielen der 41 Stichwahlen, in denen ihre Vertreter gegen Sozialdemokraten oder deutschnationale Bürgerliche standen, eine buntscheckige unnatürliche Koalition sich gegen sie geeinigt hatte. Damals wurden mit einem Schlage die Reihen ihrer Wiener Abgeordneten dezimiert, ein Ereignis, das für sie den Verlust des Luegersehen Wiener Erbes bedeutete und bis heute in der Stellung nadiwirkt, in die sich die Volkspartei als Minderheit im Wiener Rathaus gedrängt sieht. Nicht zuletzt der Dammbruch, der damals zufolge einer unnatürlichen Verschränkung der politischen Fronten geschah, die Erfahrung, welchen unberechenbaren Zufälligkeiten unter der Herrschaft des bloßen Mehrheitsprinzips für die Zusammensetzung der Volksvertretung die Führung des Staatssteuers ausgesetzt sein kann, hat in der ersten Republik zu dem Entschluß geführt, dem Beispiel anderer Staaten durch die Annahme des Verhältniswahlrechts zu folgen. Noch stärker waren zwei andere Erwägungen, die zu dem Ver-
hältniswablrecht mit gebundener Liste hinlenkten: Die Liste würde die Gelegenheit geben, in ihr und so auch in der parlamentarischen Vertretung der wahlwerbenden Partei die berufliche und gesellschaftliche Gliederung zu ihrem Recht kommen zu lassen; nachdrücklicher als bisher würde die gesetzgebende Körperschaft zum Ausdruck des Volksganzen gemacht werden. Vermochten die in den Parteien organisierten politischen Kräfte auf den Listenvorschlag Einfluß zu nehmen, ihre Besten vorauszuschicken, so würde daraus das öffentliche Leben neuen Gewinn haben.
Wieder einmal hat es sich gezeigt, daß Ideallösungen von den Realitäten des Lebens hart begrenzt werden. Die gebundene Liste des Verhältniswahlrechts erbrachte das erstrebte Ergebnis nicht. Es verschoben sich die politischen Konturen zugunsten der wirtschaftlich stärkeren Volksgruppen, gleichzeitig erfolgte in der führenden Staatspartei eine hündische Aufspaltung, die nur mit Mühe die egoistischen Sonderinteressen überwand und der programmatischen Interessengemeinschaft, dem Solidaris- mus, widersprach. Der Ausgang der Kammerwahlen der Arbeiter und Angestellten bestätigte nur den unbefriedigenden Stand der Vertretung dieser nicht nur zahlenmäßig bedeutsamen Volksschichten innerhalb der Volkspartei. Aber auch ein für Gemeinschaft und Staat so wichtiger Stand wie der des Volkserziehers, dem heute für unsere schwerbedrängte Jugend zukunftsbestimmende Aufgaben obliegen, hat zahlenmäßig niemals eine so schwache Vertretung in der Gesetzgebung gehabt wie im Zeichen des Wahlrechts der gebundenen Liste. Und eine Auswahl der Besten? Die Zahl der Nationalräte, deren Namen während der ganzen Wahlperiode von 1945 bis 1949 in dem Schweigen der Parlamentsberichte verschollen sind, ist erschreckend groß. Dem Wähler war während dieser ganzen Zeit nicht selten der Gewählte entrückt. Auch den tüchtigen Volksboten behinderte die Größe der Wahlkreise an einem engen persönlichen Kontakt mit der Wählerschaft; überdies war er nicht der einzige Verantwortliche, er hatte einer Liste angehört, aus der für die große Partei mehrere hervorgegangen waren, mit denen er seine Arbeit teilte. So gering war die Nötigung zur ständigen Fühlung mit der Wählerschaft, daß die Rechenschaftslegung der Abgeordneten in regelmäßigen Wählerversammlungen während der Legislaturperiode in manchen Landstrichen bis zur nahen Wahlzeit kaum geübt wurde. Daß diese Rechnungslegung zum größten Teil den Regierungsmitgliedern auferlegt wurde, entsprach weder deren eigentlichstem Pflich tenkreis noch der demokratischen Verantwortlichkeit aller Gewählten.
Aus den Mängeln der gebundenen Liste ist mit der Auflockerung eine Folgerung gezogen worden. Man war sich dabei bewußt, nur eine halbe Lösung zu schaffen. Seit dem Wahltag ist die gelockerte Liste erst recht von Zweifeln umflort. Noch am gleichen Tag war in Wien sich tbar geworden, daß die großen Parteien nur zögernd ihre listentragenden Stimmzettel ausgaben. Ein nennenswerter Gebrauch ist von dem Recht der Reihung und der Streichung nur streckenweise gemacht worden; dort, wo fühlbar in den Vorschlag der Liste eingegriffen wurde, bleiben innerhalb des politischen Gesinnungslagers, in dem diese Widerspräche in der Wertung der Vorgeschlagenen vernehmlich wurden, erkennbare innere
Risse zurück. Das Hintanstellen eines Bewerbers, zumal wenn es zufolge einer geräuschvollen Gruppenbewegung geschieht, wird stets, was immer die Gründe gewesen sind, für den Betroffenen eine öffentliche Minderbewertung aus den Kreisen der eigenen Gesinnungsgenossen, vielleicht eine ganz unverdiente und unter Umständen folgenschwere sein, die sich auch in sein bürgerliches Leben fortsetzen kann. Für das österreichische Parteiwesen bedeutet die Lockerung der Liste, wenn von ihr in größerem Umfang Gebrauch gemacht wird, einen zweifelhaften Gewinn. Aus der Partei erwächst dann allzu leicht die Parteiung. Aber die gelockerte Liste bedeutet auch nicht Verkleinerung des Wahlkreises, nicht die notwendige Fühlung mit den Wählern, das Ende des Zerspaltens der sozialen Gemeinschaft durch hündische Gegeninteressen, noch nicht das gerechte Ausmaß der Vertretung des Arbeiterstandes, der geistig arbeitenden Stände, nicht zuletzt des Volkserziehers.
Es wäre Schwer zu verantworten, in einer Gegenwart, in der unabmeßbare Spannungen zittern, über Mängel im Aufbau der Volksvertretung, der Herzkammer gesunder Demokratie, schweigen, ihnen gegenüber untätig bleiben zu wollen. Es wird sich geziemen, ernstlich darüber zu Rate zu gehen, wie die Wiederherstellung kleiner Wahlkreis e, engerer persönlicher Verbundenheit von Wählern und Gewählten mit dem Vorteil des Verhältniswahlrechts in größeren Wahlkreis gemcinschaf- ten zur Zählung cfer Minderheiten verknüpft werden könnte. Die hier aufgezeigte Aufgabe ist nicht auf die lange Bank zu schieben. Sie gehört zu der notwendigen Reform unseres öffentlichen Lebens.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!