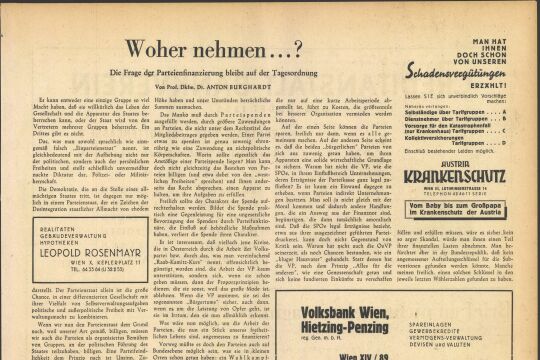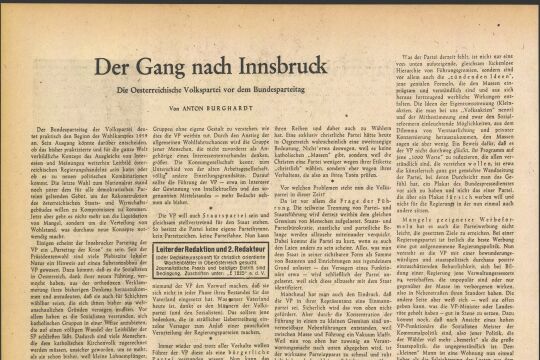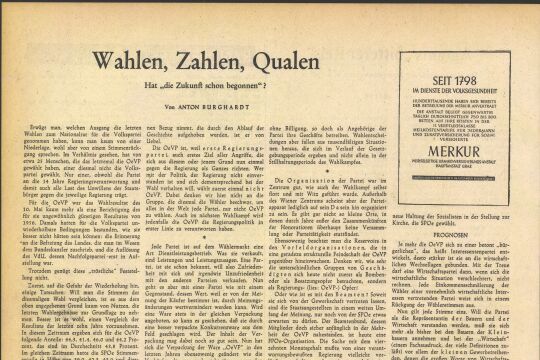Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Warnzeichen für die Demokratie
In den letzten Jahren haben sich im politischen System unseres Landes -scheinbar eine „Insel der Seligen“ oder auch ein „Hort des sozialen Friedens“ - gravierende Veränderungen vollzogen; zunächst noch recht unscheinbar und eher langsam, etwa als vereinzelte „wilde Streiks“ oder als (in den Meinungsumfragen utage tretender) verstärkter Wunsch nach „neuen, anderen“ politischen Parteien; dann aber immer rascher und deutlicher. Den vorläufigen Höhepunkt büden dabei:
• Die Wahlschlappe der Wiener SPÖ, die zwar zum Teil auf eine erneuerte, aktivere und glaubwürdigere Oppositionspartei, überwiegend aber auf die massive Stimmenthaltung von mehr als einem Viertel der Stadtbürger, darunter über 40 Prozent der wahlberechtigten Jugendlichen, zurückgeht
• Die Ablehnung des Kernkraftwerkes Zwentendorf, wobei die Mehrheit der Teilnehmer an der Volksabstimmung nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der „sozialpartnerschaftlichen Koalition“ aus Industriellenvereinigung, Elektrizitätswirtschaft und Sozialistischer Fraktion in Gewerkschaft und Arbeiterkammer das Mißtrauen ausgesprochen hat. Selbst wenn man die Stimmen einiger zehntausend bürgerlicher Protestwähler, die zwar nichts gegen Atomkraftwerke, aber viel gegen die Regierung haben dürften, vom Endergebnis abrechnet, so bleibt doch die Tatsache, daß eine anfänglich kleine Gruppe engagierter Kernkraftgegner fast ein Drittel der österreichischen Bevölkerung hinter ihren Parolen versammeln konnte.
Das Unbehagen, das zum Ausdruck kommt, sitzt tief - und wenn es sich auch nicht gegen das demokratische System als solches richtet, so doch gegen einige seiner traditionellen Träger: Parteien, Verwaltung und Interessenvertretungen.
Das ■ österreichische Parteiensystem ist lange Zeit eines der stabilsten in Europa gewesen. Wofür neben der massiven Dominanz zweier großer „Blockparteien“ auch die starken Parteiorganisationen, die relative soziale Homogenität der jeweiligen Wähler- und Mitgliederbasis und die ausgeprägten „Parteiensubkulturen“ verantwortlich gezeichnet haben.
Mit dem Anwachsen neuer, eher diffuser sozialer Schichten („neue Mittelschichten“) und der Auflösung der alten „Lagermentalität“ gerade in der jüngeren Generation verringert sich die scheinbar „naturwüchsige“ Bindung zwischen Parteiorganisation und weiten Bevölkerungsgruppen.
Diesen - unter demokratischen Gesichtspunkten eher erfreulichen -Entwicklungen haben die Parteien freilich nicht zureichend Rechnung
getragen; im Gegenteil, die vordergründige Stabilität hat zu „Betriebsblindheit“ geführt: Parteibuchbesitz wurde mit politischem Engagement verwechselt; Kritik an der „eigenen“ Stadtverwaltung wurde als Queru-lantentum oder Nestbeschmutzung abgetan; Anliegen, die - wie Umweltschutz oder Mitsprachewünsche -nicht in die etablierten Denk- und Einflußschemata paßten, wurden als „unwichtig“ abgelehnt.
Ähnliches gilt für die Interessenvertretungen, wo hohe Organisationsdichte und mangelnde politische Konkurrenz nur allzu oft zu einer „Friß-Vogel-oder-stirb“-Mentali-tät gegenüber der lange schweigsamen Basis beigetragen haben.
Die öffentliche Verwaltung - aber auch die diversen Sozial- und Verbandsbürokratien - wiederum hat mit der Übernahme neuer Aufgaben ihre Tätigkeit ständig ausgeweitet und immer mehr in das tägliche Leben der Bürger eingegriffen. Diesem ständigen Zuwachs an Macht und Kompetenzen steht freilich kein entsprechender Zuwachs an Transparenz gegenüber: die Verwaltung ist zwar „hautnäher“, nicht aber „bürgernäher“ geworden.
Während sich der Bürger so auf der einen Seite immer mehr von bürokratischen Apparaten übermächtigt fühlt, fehlt es ihm auf der anderen Seite offensichtlich an geeigneten politischen Artikulationsmitteln für neue Anliegen und Probleme - nicht zuletzt für jene, die aus dem Verhältnis Verwaltung/Verwaltete resultieren.
So ziehen es dann 12 Prozent der Wiener SPÖ-Mitglieder vor, anstatt zur Wahl ins Grüne zu fahren, engagieren sich kritische Jugendliche lieber in der Anti- Atomkraft-Bewegung als in den Jugendorganisationen der Parteien und suchen frustrierte Bürger ihr Heil eher in einer Bürgerinitiative als in den lokalen Parteiorganisationen. '
Inwieferne diese Entwicklung nun zu einer Belebung der Demokratie (etwa durch einen Bedeutungsgewinn basisdemokratischer Initiativen und Entscheidungsformen) oder zu einer Gefährdung derselben überleitet, wird nicht zuletzt von der Reaktion der Parteien und ihrer führenden Politiker abhängen: ob sie nämlich zu einer Öffnung ihrer Strukturen und zu einem Aufgreifen bürgerschaftlicher Initiativen bereit sind, oder ob sie versuchen, ihre etablierten Positionen durch Ignorieren, Totlaufenlassen und Unterdrückungsversuche zu halten. Der letzteren Strategie mag dabei vielleicht zeitweiser Erfolg beschieden sein, langfristig riskiert sie freilich, das Unbehagen an den Parteien in ein Unbehagen an der Demokratie zu überführen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!