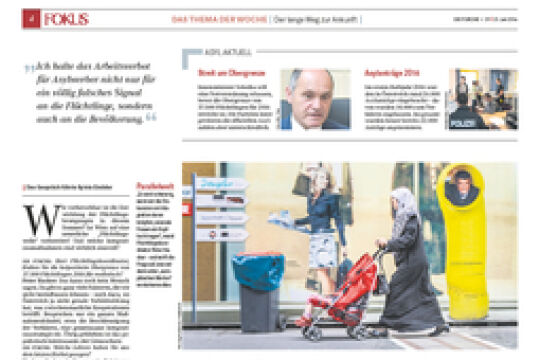Bildungscheu, integrationsunwillig und inkompatibel mit unseren Werten? Manchen Behauptungen über Migranten halten sich hartnäckig. Die FURCHE fragte bei Experten nach, was dran ist.
Knapp 8,4 Millionen Menschen leben in Österreich, 970.000 von ihnen wurden nicht hier geboren. Dazu kommen noch rund 415.000 Menschen, deren Eltern im Ausland geboren wurden, die sogenannte "zweite Generation“. Und das ist gut so: Ohne Zuwanderung würde Österreich rasch schrumpfen. Im Jahr 2040 würden weniger als acht Millionen hier leben, 2075 nicht einmal mehr sechs Millionen.
Das multikulturelle Zusammenleben funktioniert oft gar nicht so schlecht, wie es die politische Debatte vermuten lässt: Eine Umfrage des Österreichischen Integrationsfonds ergab im Dezember, dass 59 Prozent der Österreicher mit dem Zusammenleben zufrieden sind. Und laut der letzten großen Integrationsstudie von Meinungsforscher Peter Ulram fühlen sich 87 Prozent der Migranten in Österreich einigermaßen heimisch und integriert. Trotzdem wird kaum eine Diskussion so hitzig geführt, wie die über Zuwanderung. Die FURCHE hat mit Integrationsforschern und Sozialwissenschaftern gesprochen, um gängigen Mythen auf den Grund zu gehen.
These zur Bildung:
In Bildungstatistiken schneiden Zuwanderer schlechter ab als Österreicher. Das beweist, dass sie bildungsunwillig sind.
Pauschal lässt sich das nicht sagen. Unter Migranten gibt es zwar mehr Personen mit einfachem Bildungsgrad aber auch mehr Akademiker als unter Österreichern. Allerdings: Während die Wahrscheinlichkeit, dass ein 15- bis 19-jähriger Österreicher, der die Pflichtschule abgeschlossen hat, in Ausbildung ist, bei 90 Prozent liegt, sind es bei Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugoslawien nur 70 Prozent, und bei Jugendlichen mit türkischen Wurzeln nur mehr 60 Prozent. Gibt es in Haushalten mit Migrationshintergrund also einen Widerstand gegen Bildung, der vielleicht sogar mit Strafen gebrochen werden muss?
Der Mikrozensusforscher August Gächter vom Zentrum für Soziale Innovation hat jetzt untersucht, welche Auswirkung die äußeren Umstände, unter denen Kinder aufwachsen, auf deren Bildungsbeteiligung haben, und kam zu spannenden Ergebnissen: Der Herkunftsstaat ist nur der elftwichtigste Faktor mit Auswirkung auf die Bildungsbeteiligung. Viel wichtiger sind Bildung, Beruf und Jobsituation der Eltern oder die ökonomische Situation des Haushaltes. Wenn man diese Faktoren in der Statistik angleicht, also annimmt, dass der durchschnittliche türkischstämmige Haushalt unter den selben Umständen lebt, wie der durchschnittliche österreichische Haushalt, liegt die Bildungsbeteiligung bei allen Jugendlichen - egal welcher Herkunft - bei 90 Prozent. Gächters Fazit: "Wenn die Umstände gleich sind, ist es auch die Bildungsbeteiligung.“
These zur Sprache:
Deutsch ist der Schlüssel zur Integration. Wer die Sprache nicht kann, hat keine Chance.
Natürlich lässt sich die Rolle der Sprache im Integrationsprozess nicht klein reden. Der Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt hängt stark davon ab. "Aber zu einem Schlüssel gehört auch ein Haus mit einer Tür, die sich mit dem Schlüssel öffnen lässt“, gibt Hans-Jürgen Krumm, Germanistikprofessor an der Universität Wien, zu bedenken. Für Kinder, die hier aufwachsen, ist die Bedeutung von Sprachförderung - so viel und so früh wie möglich - unumstritten. Für Erwachsene, die einwandern, nicht.
"Wie viel Sprache und ab wann man sie können muss, lässt sich nicht eindeutig beantworten“, sagt Krumm: "Hervorragende Sprachkenntnisse haben noch niemanden vor einer Abschiebung bewahrt oder Einheimische wie Migranten vor Arbeitslosigkeit geschützt.“ Er warnt daher vor einer "Es-kommt-nur-auf-die-Sprache-an-Obsession“ und appelliert, dass die Verpflichtung zu Deutschkursen an Anreize statt an Sanktionen gekoppelt werden soll. Außerdem soll man nicht nur nach der einen Sprache fragen, sondern auch danach, welche anderen Sprachen und (beruflichen) Qualifikationen Migranten mitbringen.
Von rund 40 Prozent aller Ausländer, die in Österreich leben, wird im Übrigen gar kein Sprachnachweis verlangt: Sie kommen aus anderen EU-Ländern und dürfen auch ohne Deutsch-Zeugnis hier leben.
These zur Staatsbürgerschaft:
Am Ende einer erfolgreichen Integrationskarriere steht die neue Staatsbürgerschaft.
Momentan ist das so. Erst wer mindestens zehn Jahre unbescholten in Österreich lebt, einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen kann und Sprach- und Landeskundeprüfungen bestanden hat, kann um die Staatsbürgerschaft ansuchen. Wenn die Behörde ihre Zusage erteilt hat und knapp 1.000 Euro bezahlt sind, ist im Normalfall gleichzeitig die alte Staatsbürgerschaft weg. Das kritisiert der Wiener Migrations- und Integrationsforscher Bernhard Perchining: "In allen Ländern, in denen die Staatsbürgerschaft ein Schritt der Integration, und nicht deren Endpunkt ist, hat sich das positiv auf die Integrationsbemühungen ausgewirkt.“ Als Positiv-Beispiel nennt er Kanada. Dort gibt es eine schnelle und unbürokratische Einbürgerung - und die Anerkennung von Doppelstaatsbürgerschaft. In Österreich ist das nur in Ausnahmefällen möglich. Die Einbürgerungsrate ist deshalb sehr niedrig: Von 1000 Ausländern, die ihren Hauptwohnsitz im Land haben, erhielten im Vorjahr nur sieben die österreichische Staatsbürgerschaft.
These zur Herkunft:
Die Integration von bestimmten Gruppen funktioniert offensichtlich nicht gut.
Das behauptete man auch über die Deutschen in der Hauptphase der deutschen Einwanderung in die USA Mitte des 19. Jahrhunderts. Man warf ihnen vor, dass sie sich weigerten, Englisch zu lernen und Ehepartner aus der alten Heimat holen. Ähnlich ging es den Iren in Großbritannien: Sie würden nur auf den Papst hören und sich nicht an das liberale Wertesystem anpassen.
In der Wissenschaft hält man sich ans Drei-Generationen-Schema: Rund hundert Jahre, oder eben drei Generationen, braucht es, bis eine Gruppe von Zuwanderern, die nicht hochgebildet ist, als assimiliert gilt. Der Soziologe August Gächter ortet überdies ein Wahrnehmungsproblem: "Es gibt laufend neuen Zuzug, also eine immer neue erste Generation, die wieder drei Generationen brauchen wird. So entsteht der falsche Eindruck, dass Integration eine Sisyphusarbeit ist.“
These zur Integration am Land:
Städte haben eine längere Zuwanderungstradition. Die Integration funktioniert dort deshalb besser als in kleinen Gemeinden.
Zuwanderung ist zu einem großen Teil ein urbanes Phänomen - in Städten gibt es traditionell einfach mehr Erwerbsmöglichkeiten als in ländlichen Gebieten. Das zeigt auch ein Blick auf die Statistik. 33 Prozent aller Wiener und 30 Prozent aller Salzburger haben ausländische Wurzeln. Trotzdem ist Zuwanderung kein Hauptstadt-Phänomen: Auch im Bezirk Wels hat beinahe jeder Dritte Migrationshintergrund, in Vorarlberg jeder Fünfte und in Attnang-Puchheim oder Reutte jeder Sechste. Tendenz steigend: Zwischen 30 bis 40 Prozent der Neuzuwanderer zieht es in Österreich in den ländlichen Raum. "Die Aufgabe der Gemeinden beim Thema Integration ist aber erst in den letzten Jahren ins Bewusstsein gerückt“, meint Kenan Güngör, Soziologe und Experte für Diversitätsfragen
Leichter sei die Integration in der Stadt deshalb trotzdem nicht, sie funktioniere aber ganz anders: "Die behauptete Toleranz der Städte liegt vor allem darin, dass die Stadtmenschen indifferenter zueinander sind. In einer heterogenen, anonymeren Gesellschaft irritiert das Fremde nicht so sehr.“ Im ländlichen Raum hingegen, wo man sich öfter begegnet und die soziale Kontrolle größer ist, werde man länger als Fremder wahrgenommen. Außerdem gibt es weniger NGOs, Initiativen und Vereine, die sich aktiv um Integration kümmern. Aber: "Wenn man einmal integriert ist, ist das verbindlicher“, sagt Güngör: "Dann wird man lebensweltlich aufgenommen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!